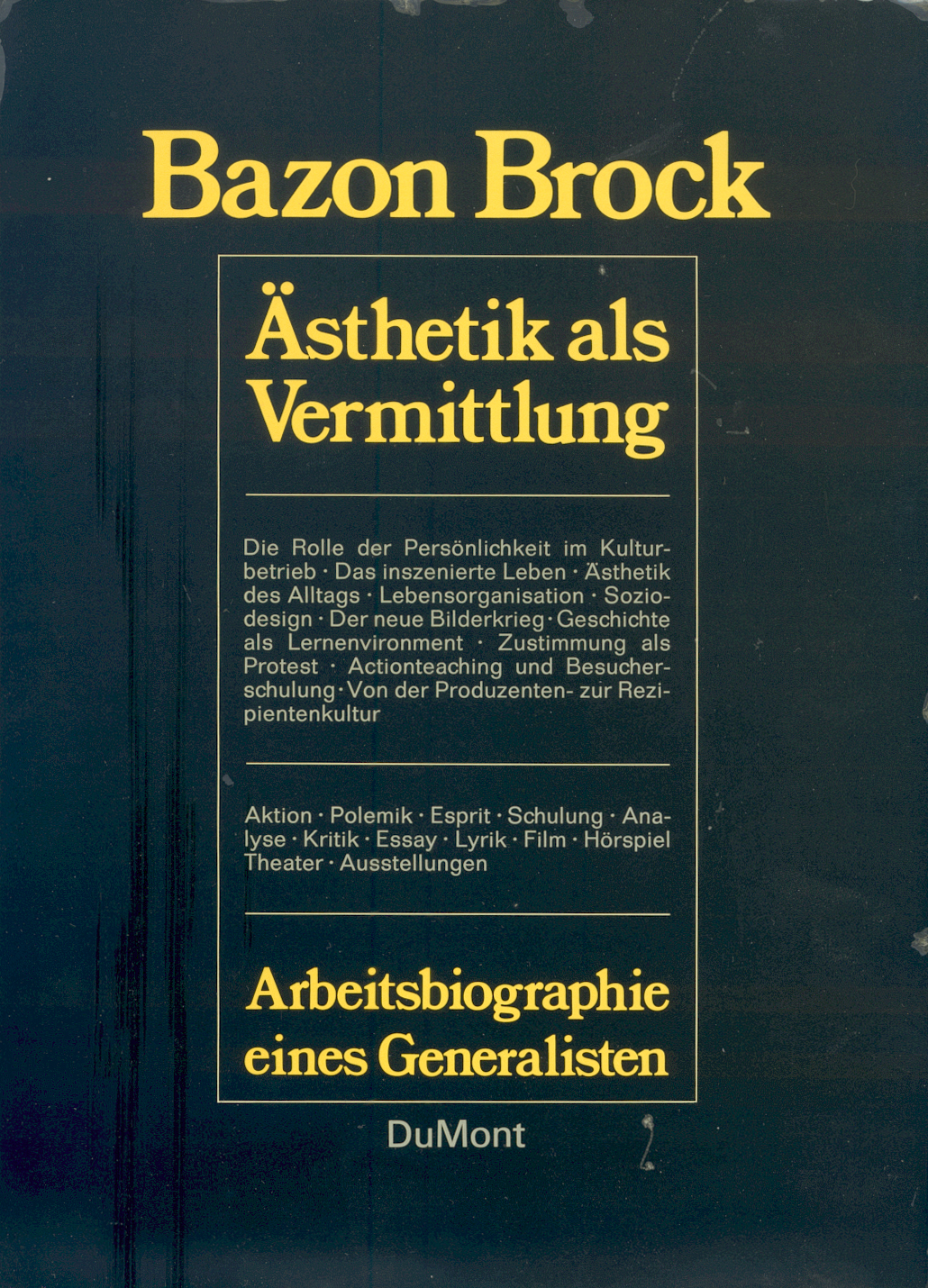Mit diesem ZEIT-Artikel vom 27.12.1968 beteiligt sich Bazon Brock an dem hitzigen Streit des Berliner und Heidelberger SDS contra die ‚bürgerliche Feuilletonisten‘ (HANDKE, HAMM, LEONHARDT, LARASEK u.a.). Die Kontroverse wurde unter dem Thema ‚Kunst als Ware‘ über 16 Folgen der ZEIT vom November 1968 bis Januar 1969 geführt. Dieser Themenkomplex wird schwerpunktmäßig dann in Band III ‚Ästhetik der Alltagswelt‘ fortgeführt; vgl. dort speziell den Beitrag ‚Emanzipatorische Errungenschaften der Kulturindustrie‘, 1971 (in Teil 1,3) und den Abschnitt ‚Mode und Körperdesign‘ (in Band III, Teil 3).
Der zum Lesen dieser Sätze durch die ihnen vorhergegangenen schon motivierte Kulturfreund soll eine Steigerung seiner Aufmerksamkeit erfahren. Deshalb beantworte ich zunächst die hier mehrmals gestellte Frage "Warum kürzere Röcke?"
Die Röcke wurden kürzer, weil eine Reihe von Leuten in ihrer sozialen Umgebung so unterbestimmt waren, daß ihnen daran gelegen sein mußte, eine Kennzeichnung zu erhalten, mit der sie ihren normalen Zustand der Unsicherheit, der Vereinzelung und der Ununterscheidbarkeit etwas abschwächen konnten. Indem sie kürzere Röcke trugen, wurde ihnen die Kennzeichnung "modern, eigenwillig, selbstsicher, fortschrittlich, jugendlich" von seiten ihrer sozialen Umgebung zugestanden.
Veränderungen in unserem Habitus kommen am leichtesten zustande, wenn wir arme Schweine sind, das heißt eben, wenn wir nicht wissen, wer wir sind. Es ist bezeichnend, daß die kürzeren Röcke sich zunächst in den Milieus der Arbeiter und Angestellten durchsetzten. Zum erstenmal übrigens ist damit die Mode zur gesellschaftlichen Kennzeichnungsmöglichkeit der Deklassierten geworden und damit essentiell. Der New Look noch wurde als letzte große Modewende von den Schichten des gehobenen Mittelstandes getragen. Es scheint auch einsehbar, daß niemand durch modische Attribute soziale Kennzeichnungen zu erkämpfen braucht, der zu den 'Bessergestellten' gehört, und das heißt, der die sozialen Kennzeichnungen 'Direktor, Doktor, Präsident, Vorstand, Ältester, Präses, Familienoberhaupt usw.' für sich in Anspruch nehmen kann.
Soziale Kennzeichnungen sind nicht kostenlos zu haben bei uns. Da ein großer Bedarf an solchen minimalen Kennzeichnungen besteht, wie sie "modern, fortschrittlich und jung" suggerieren, kosten die Miniröcke eine ganze Menge. Auf Kosten der Miniträgerin, die sich nun jung und modern nennen durfte, legten sich andere die Kennzeichnung 'Direktor usw.' zu. Das ist ohnehin der Alltag kapitalistischer Produktionsweise. Aber: hatte man geglaubt, durch das Höherrutschen des Rockes auch den leichteren Zugang zu dem, was unterm Rock ist, zu erreichen, so sah man sich getäuscht, als Mann. Denn was da zum Vorschein kam beim Höherrutschen der Röcke war nur für wenige Monate das alte lustbesetzte Potential zwischen Strumpfende und Höschenanfang. Dann kam hervor, was auch so schon sichtbar war: Strumpf-Strumpf, sauber, durchgängig, zugeschnürt bis oben hin - die Frage, ob denn was Schönes drin sei, blieb unbeantworteter als zuvor.
So war nämlich das Zugeständnis 'Minirock' nicht gemeint, gerade deren Fabrikanten beeilten sich zu verkünden, daß, wer einen Minimini trägt, viel schwerer zu haben ist als ein Suschen, weil eben Minimädchen hübscher sein müssen. Und hübsche Mädchen gehen nicht mit jedem sofort aufs Brett.
Als sich vor Monaten dieser Mechanismus allzu weit enthüllt hatte, "wanderten die Mädchen, geführt von der Konkurrenz der Minimacher, zur Hose ab, und Paris blieb auf seinen Röcken sitzen" (Fachpresse im Frühsommer). Die Strumpfhosenhersteller haben inzwischen einen Dreh gefunden, verlorenes Terrain wiederzuerobern: sie wissen die Zone unterm Rock erneut zu tabuieren und damit interessanter zu machen, indem sie z.B. durch Sloggy, den Höschenberater, verkünden lassen, der Slip gehöre über die Strumpfhose.
Mit Recht wird von den Fabrikanten ein solcher Vorgang "Revolution" genannt, denn bisher waren ihre Kundinnen auf das ganze Gegenteil getrimmt worden: der Slip gehöre unter die Strumpfhose.
Mir scheint, als ob auch wir hier in der ZEIT die Revolution als eine Frage nach der Slip-Strumpfhosendominanz abhandeln: ob denn nun alles verkehrt werden soll, ob nicht alles von unterst zu oberst gekehrt werden wird.
Bisher haben wir aber nur den Augenblick als revolutionär empfinden können, in dem wir die Hosen ausziehen und wenigstens für Halbstunden unser Modell der Versöhnung betreiben. Nicht umsonst waren die großen Liebhaber immer auch große Revolutionäre: denn die Revolution, das ist die Versöhnung, das ist der Zusammenhang aller mit allen, das ist der Zustand, in welchem nichts geschieht, ohne daß es gewollt geschähe, von uns gewollt.
Diese Revolution gibt es noch nicht oder doch nur für Privatiers und auf kurz,
Deshalb 2.
Versöhnung kann nicht stattfinden. Einverständnis soll nicht erschlichen werden, und wer ein Wort des Trostes spricht, ist ein Verräter.
Die augenblickliche Situation wird bestimmt durch Anerbieten, sich zu arrangieren, den guten Kompromiß zu erreichen, den mittleren Weg zu gehen (der als einziger nicht zum Ziel führt).
Ausdruck solcher Bemühungen ist der Versuch, die allseits als notwendig bezeichneten Veränderungen durch bloße strukturelle Maßnahmen real werden zu lassen: Mitbestimmungsgesetz, Hochschulverfassungsänderung. Das sind bloße formale Kennzeichnungen, die auch dadurch nicht materiale werden, daß sie von parallelen Institutionalisierungsmaßnahmen begleitet sind. So hat es doch das Otto-Suhr-lnstitut herrlich weit gebracht bei den strukturellen Veränderungen des Institutslebens - indes das Institut ist arbeitsunfähig, weil die Studenten inzwischen verstanden haben, daß nur materiale Bestimmungen tatsächliche Einheit der Lebenspraxis ermöglichen.
Materiale Bestimmungen unseres Lebens sind nach heutigen Gegebenheiten ausschließlich in realen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen zu erreichen: im Kampf, in der Thematisierung der eigenen Lebensbedingungen.
Dieser Kampf hat erst zu beginnen; diese realen Auseinandersetzungen müssen sich erst einmal entfalten.
Wir haben diesen Kampf endlich aufzunehmen.
Wir dürfen ihn nicht durch bereitwillige Zugeständnisse aus unserer jeweiligen Lebensumgebung heraushalten.
Auch die ZEIT-Redakteure müssen endlich durch ihre Arbeit dazu beitragen, daß sich die realen Auseinandersetzungen in unserer Gesellschaft entfalten können. Tragen die ZEIT-Redakteure schon dazu bei?
Der SDS reagiert so unfreundlich auf Herrn Leonhardts freundliches Angebot, weil Herr Leonhardt offensichtlich nicht bereit ist, den Kampf aufzunehmen, sondern in ihm als Schlichter oder Vermittler auftritt. Leonhardt reagiert gekränkt, zumindest gereizt, weil er nicht verstehen kann, daß es nicht ausreicht, den SDS zu Worte kommen zu lassen, nur weil man doch möglichst allen zugestehen sollte, ihre Meinung zu sagen. Das wäre in der Tat nur "Verstellung der Wirklichkeit durch abstrakte Regeln von Fairneß".
Wir müssen auch Leonhardt bitten, durch Formulierung und Organisation die Bestimmungsformen seines Lebens anzugeben und (soweit er das kann) aus ihnen oder gegen diese Bestimmungsformen seine Interessen deutlich werden zu lassen. Denn diese Interessen bestimmen wesentlich den realen Kampf, dem wir auch durch die raffiniertesten Kampfregeln nicht ausweichen können. Die Auseinandersetzungen dürfen nicht im Ritual untergehen, obwohl wir solche Rituale ja erst zur Vermeidung der Auseinandersetzung ausgebildet haben.
Wir haben zu zeigen, daß wir selber der Fall sind, von dem wir da handeln.
Handke hat das nicht gezeigt, er scheint es auch nicht zu wissen.
Peter Hamm hat ihm das vorgehalten. Ich halte es ihm nicht vor, ich möchte ihn überzeugen zu kämpfen. Er hat sich auf formale Bestimmungen zurückgezogen, denn seine Einwände betreffen nur die Grammatik spezieller Kommunikation. Wenn aber Handke glauben sollte, daß sich im allgemeinen, quasi im platonischen Dialog, solche Bedingungen angeben lassen, die der SDS zu Bestimmungen unseres Lebens gemacht sieht, dann wäre er selbst nur Opfer dieser Bedingungen. Das scheint sehr häufig der Fall zu sein, wenn in seinen Texten die Automatik des Sprechens und Assoziierens sich allzu stark durchsetzt. Das hat ihn bereits zu kuriosen Aussagen geführt, die er im Falle Brecht widerrief. Handke wird das Opfer ihn bestimmender Bedingungen, wenn er glaubt, sich als Literat äußern zu können, also als Privatmann und nicht als Produzent. Äußert sich Handke aber als bürgerlicher Literat, dann kann ihm, infolge der Techniken der Textmaterialisation, kaum klarwerden, worüber sich die SDS-Autoren geäußert haben.
Seine Widerrufe und Umkehrungen scheinen aber anzuzeigen, daß Handke seinen Fall objektivieren könnte, wenn er begänne zu kämpfen, und das heißt, wenn er sich selbst der Thematisierung der Rolle der Literaten als Produzenten bediente (was er einmal kurz in Princetown versucht hat). Als erster neuer Schritt dahin wäre ihm vorzuschlagen, sich anderer Techniken der Textmaterialisation zu bedienen, zumindest aber die bisher von ihm angewandten aufzugeben: die der Tautologiebildung, der Kopulabestimmung, der Umkehrung, der guten alten Assoziationsreihung. Kampf müßte für ihn wohl anfangen beim Zerschlagen der Assoziationsketten, deren willkürliche Produktion bei jedermann heute tiefster Ausdruck seiner Bestimmungslosigkeit ist.
Wenn sich HANDKE als Literat äußert, dann heißt das: er äußert sich als jemand, der ohne weiteres über die Produktivmittel verfügt, die er für nötig hält, um zu machen, was ihm einfallt. Schließlich arbeiten unsere Literaten mit den kümmerlichen Produktivmitteln Schreibmaschine und Papier, die man doch jederzeit auftreiben kann. Handke hat nicht ein einziges Mal die leisesten Schwierigkeiten gehabt, sich in die Verfügung über das Produktivmittel Bühne zu setzen. Dr. Braun tats für ihn. Woher soll er wissen, daß ästhetische Praxis abhängig ist von den Produktivmitteln Schauspieler, Bühne, Verlag, Maschinenpark, von verschiedenen Materialisationsverfahren, Technologien, Wissenschaften? Und Theoriebildung als notwendigen Bestandteil heutiger Produktivmittel ästhetischer Praxis scheint Handke überhaupt noch nicht erfahren zu haben. Er benutzt einen Wittgenstein zu Zwecken privater Rationalisierung. Ich kann immerhin brüderliche Verantwortung aufbringen für einen Fall wie diesen oder den von Enzensberger oder den von Grass und aller lieben Literaten mit Bleistift und Papier: weil ich ahne, daß ich auch so enden könnte, wenn mich, durch welchen Umstand auch immer, das Unglück noch weiter duckt. Vorsichtshalber will ich wohl für mich in solchem Fall um Verständnis bitten.
Bisher aber bin ich diesen lausigen Literaten um etliches voraus: ich habe mich nämlich unendlich viel weiterentfaltet in der Dimension der bürgerlichen Individualität. Ich habe fast ihren höchsten Entfaltungsgrad erreicht, den exzeptionellen, den einmaligen, den unwiederholbaren, den des bürgerlichen Künstlers als Genie. Ich weiß, welchen Bedingungen ich gehorche und wie weit mir die Scheiße am Halse steht. Während genannte Herren nichts lieber tun, als sich aus den Bestimmungen der bürgerlichen Kunstideologie hinauszuschwindeln, kann ich unmittelbar und konkret angeben, daß wir immer noch dieser bürgerlichen Kunstideologie die entscheidendsten Bestimmungen ästhetischer Praxis als gesellschaftlicher Praxis verdanken.
Und ich vermag vor allem, die Bestimmungen als historische auszuweisen, wende sie nicht an, um mich durch sie zu rechtfertigen. Das dürfte jeder mitbekommen haben, der an einer Veranstaltung teilnahm, die ich zu verantworten hatte. Identifizieren kann sich niemand mit mir, denn dafür bin ich zu arrogant.
Wenn ich mich in der Sphäre bürgerlicher ästhetischer Praxis aufhalte, wird diese selber als eine historische aufhebbar. Das ist etwas anderes, als wenn man durchs Land läuft und verkündet, die Kunst sei tot. Ich finde es rühmenswert, daß die SDS-Autoren sich nicht auf dieses Idiotengeschrei eingelassen haben, das jetzt erzreaktionäre Herren wie Boehlich und Enzensberger und Michel anstimmen, Was nur je aus dem Bild des Spießers und der Kanaille herauszulocken war, präsentieren sie mit dem Mutwillen von Verstandeslosen. Vor allem deren Opportunismus und Bedingungslosigkeit. Wenn je diese Herren vorgaben, über sich mehr erfahren zu können als ein Arbeiter über sich, wenn je sie über das Unglück, unser Leben nicht selbst bestimmen zu können, etwas auszumachen in der Lage waren (und das waren sie), dann sollten sie sich den Trick ersparen, bloß vom Tisch zu zaubern, was ihnen nicht mehr geheuer ist, weil sie mit ihrem Latein am Ende sind. Heute wird chinesisch gesprochen.
Was sollte das wohl für einen Sinn hahen, vom Kunstwerk anders als von speziellen Hervorbringungen der feudalen und bürgerlichen Gesellschaft zu sprechen. Ist denn die bürgerliche Gesellschaft tot? Und wenn sie es erst einmal ist, dann werden die Formen früherer ästhetischer Produktion nur um so bedeutender für uns sein. So wie Museumsgegenstände erst dadurch bedeutend werden, daß sie als aktuale Formen, als das, was jetzt gilt, nicht mehr betrachtet werden. Die aber erst aus diesem Nichtgelten, ihrer spezifischen Distanz zum jeweiligen Entfaltungsstand der realen Gesellschaften ihre Bedeutung erhalten. Seit 150 Jahren faßt eine Kategorie der Dialektik diesen Tatbestand: Aufhebung.
Was sollte es wohl für einen Sinn haben, von Kunstwerken anders als von Waren zu sprechen. Haben diese Herrschaften je angenommen, was sie betreiben, könnte sich den Gesetzen der Zirkulation von Produziertem entziehen? Aber wieso fällt es diesen Herrschaften wie Schuppen von den Haaren, wieso sind sie plötzlich so durchgedreht, wenn auch ihnen verständlich wird, daß Kunstwerke Waren sind? Ihr Widerstand gegen die Bedingungen gesellschaftlicher Produktion ist zusammengebrochen, sie selbst sind betroffen - das ist kein Schade, denn diesen Widerstand eines Enzensberger hat das System mühelos selber produziert.
Marx hat die Rolle der Bourgeoisie für die Revolution überschwänglich gefeiert: es sollte hier die ZEIT selber gefeiert werden. Denn die Bedeutung, die Bongards Kunstmarktseite im Wirtschaftsteil hat für den revolutionären Kampf im Bereich der ästhetischen Praxis, ist unvorstellbar groß (zumindest im Hinblick auf so magere Beiträge wie die von Enzensberg, Boehlich oder Michel). Sein Warencharakter hat nie und kann unmöglich dem Kunstwerk plötzlich das historische Stündlein blasen. Er ist seine erste Bedingung. Bildenden Künstlern ist das heute sehr viel eher klar zu machen als den Literaten, denn sie sind der allgemeinen Entfaltung der Produktivmittel viel näher und desto schrecklicher dem Zwang der herrschenden Produktionsverhältnisse ausgesetzt. Mangels Masse ist den meisten Literaten niemals die Differenz zwischen Tauschwert und Gebrauchswert ihrer Produkte aufgefallen. Die bildenden Künstler beginnen bei dieser Differenz. Sie hatten immer schon einen großen Vorsprung. Und sie sind auch heute diejenigen, welche ästhetische Produktionen ohne Tauschwert realisieren.
Eine der entscheidenden Funktionen der Kunst in der feudalen und bürgerlichen Gesellschaft ist es, die objektive Misere des Lebens erträglich werden zu lassen. Ich jedenfalls wäre sehr dankbar gewesen, wenn ich 1780 aus Werthern Rechtfertigungen für Handlungsweisen hätte entnehmen können, denen ich unterlag. Ich hätte mir gerne Begründungen dafür zuspielen lassen, warum ich nicht sofort zum Revolver hätte greifen müssen. Die bürgerlichen Individuen hatten sich schon zu solcher Subjektivität entfaltet, daß nur die ausgeklügeltsten Verfahren der Tröstung, der Hoffnung und der Rechtfertigung in der Lage waren, sie vor unmittelbarer Selbstzerstörung zu bewahren. Und diese Verfahren entwickelten die Künste. Denn reale Befreiung war nicht gegeben; die ist abhängig von dem Stand der Naturbeherrschung. Bis in unsere Zeitläufte war Hoffnung das einzig Reale.
Inzwischen sind die allgemeinen Produktivmittel so weit entfaltet, daß solche Befreiung wirklich werden kann, und jede bloße Hoffnung wird Tendenz der Reaktion.
Die Künste haben diese Funktion verloren. Sind sie ihrer übrigen auch entkleidet? Das zu behaupten, wäre wohl nur denjenigen als verständlich gestattet, die bisher ganz aus dieser Funktion bestimmt wurden. Können Einzelne heute etwas Richtiges tun, dann haben die SDS-Autoren die Situation der Künstler und ihrer Tätigkeit richtig analysiert - ihre Situation gegenüber den Produktionsverhältnissen. Ich ziehe andere Schlüsse aus dieser Analyse als der SDS. Das ist aber nicht wichtig.
Wichtig hingegen ist, die Stellung der Künstler als Produzenten innerhalb des Produktionsprozesses zu beschreiben. Es gibt bisher dazu nur zwei Ansätze. Den ersten lieferte Benjamin in seinem Aufsatz 'Der Autor als Produzent' 1934. An dem zweiten arbeiten Studenten und Dozenten der Staatlichen Hochschule für Bildende Künste in Hamburg seit drei Jahren. Rezeptionsausbildung steht dabei in vorderster Linie. Die Strategie der affirmativen Praxis ist ausgearbeitet und vielfach erprobt. Kommen Sie mal rüber, wir helfen gern. Vor allem den Herren Handke und Zimmer. Mit der SDS-Projektgruppe 'Kultur und Revolution' hingegen würden wir sogar zusammenarbeiten, damit sie nicht mehr auf Henze angewiesen ist.
Die Bedeutung der ästhetischen Praxis für die Zukunft wird größer sein, als sie es für die feudale und bürgerliche Gesellschaft gewesen ist. Schon deshalb, weil Wissenschaften und Künste in die Basis abgestiegen sind: sie wurden selber Produktivmittel. Doch auch die Funktionszuweisungen haben sich erhöht, was man allerdings erst versteht, wenn man die aktualen Formen heutiger ästhetischer Praxis kennt. Sie zu vermitteln, wäre Aufgabe der Feuilletonredaktion der ZEIT, wenn deren Mitglieder tatsächlich beginnen sollten, ihre Interessen zu organisieren.
Sind die Künste infolge der Bedingungen ihrer jeweiligen Hervorbringung wesentlich bestimmt, dann werden sie anders zu bestimmen sein, wenn sich diese Bedingungen ändern. Sie haben sich geändert.