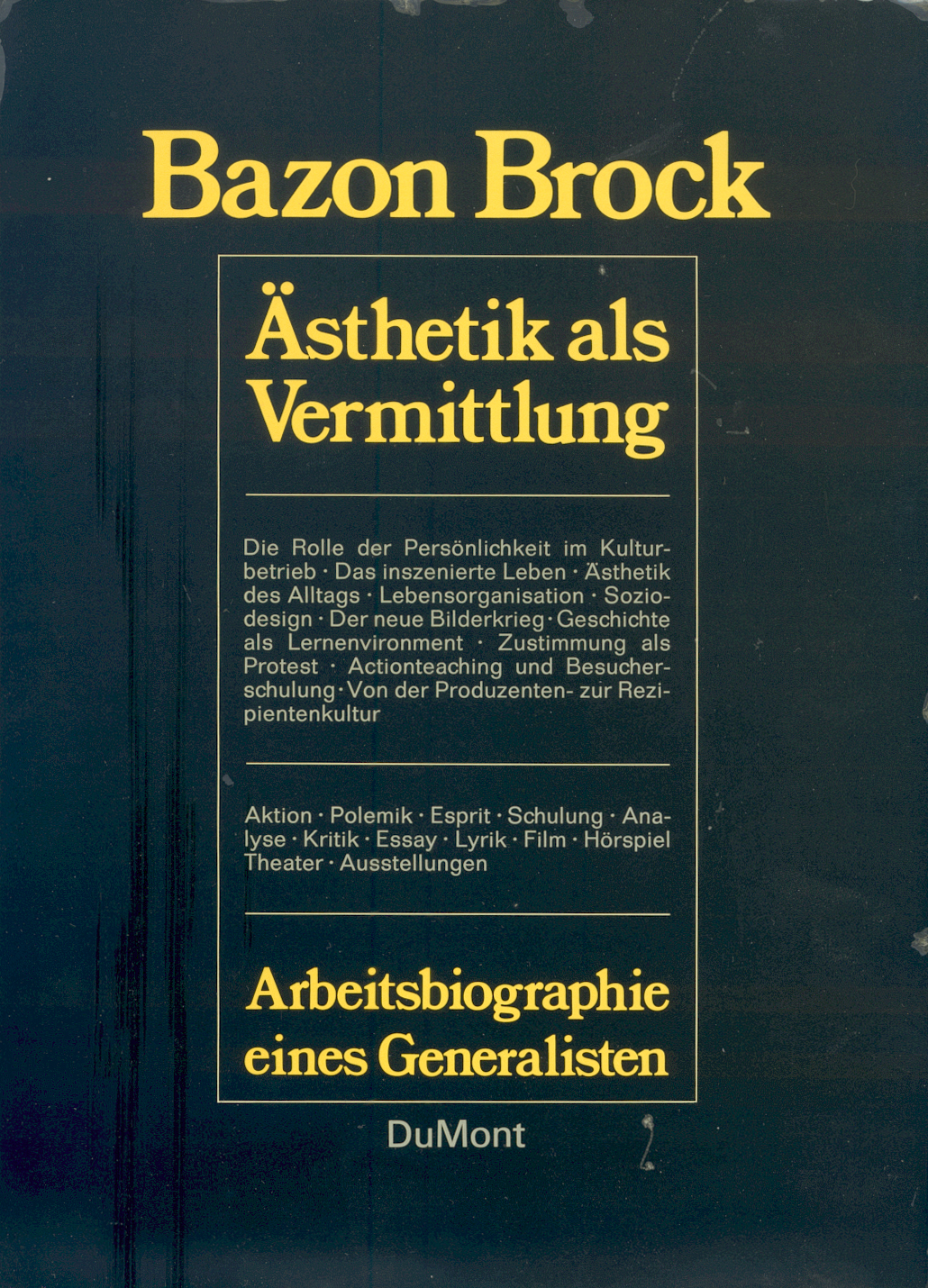Das Interview führte Gisela BRACKERT für den von ihr herausgegebenen Band 'Kunst im Käfig. Thesen zum Thema Kunstausstellung', Edition Kölling, Black Spring Verlag & Galerie, Frankfurt am Main 1970. Der Interviewstil wurde beibehalten.
Brackert: Auf keinem Sektor war die Moderne so erfolgreich wie auf dem Gebiet der bildenden Kunst. Nicht nur die Zahl der von den aktuellen Ausstellungen Angesprochenen ist Legion im Vergleich zu den Experimenta-Besuchern, den Nachtprogramm- und Musica-Viva-Hörern. Auch die produktiven Talente drängen heute vorwiegend in die bildende Kunst. Woher kommt das?
Brock: Die Bevorzugung der Hervorbringung aus dem Bereich der bildenden Kunst gegenüber denen aus anderen Praxisbereichen hängt nach meiner Ansicht damit zusammen, daß die bildende Kunst ihre Hervorbringungen in Form von Objekten manifest werden läßt, während die meisten Realisate aus den anderen ästhetischen Praxisbereichen vom Charakter eines Prozesses sind. Wenn aber ästhetische Erscheinungen nur im aktualen Prozeß zu rezipieren sind, dann wird vom Rezipienten eine erheblich größere Arbeitsleistung verlangt, als wenn er einen Gegenstand oder ein Objekt rezipiert.
Der Rezipient im Bereich der bildenden Kunst kann das Kunstwerk als Objekt fetischisieren. Immer, wenn er diesen Fetisch anschaut oder handhabt, dann wird quasi stellvertretend für den Rezipienten alles das manifest, was er normalerweise als eigene Leistung zu erbringen hätte. Der Rezipient im Bereich der bildenden Kunst kann auf diesem Wege der notwendigen Kommunikation zwischen verschiedenen Subjekten entgehen; er monologisiert nur noch, und diese Kommunikation mit sich selbst über das Objekt bedeutet erhöhte Sicherheit, Vermeidung der Angst vor Einspruch oder Widerspruch, Unaufhebbarkeit der einmal getroffenen Feststellung.
Entscheidend für die Bevorzugung der bildenden Kunst durchs Publikum sind zweitens ganz reale ökonomische Bedingungen, die dem Produzieren und Rezipieren von bildender Kunst zugrunde liegen. Denn an Objekte kann man ökonomische Attribute hängen, was man bei ästhetischen Realisaten vom Charakter eines Prozesses eben nicht tun kann. Realisate, die bloße Prozesse sind, stellen bestenfalls einen Gebrauchswert dar. Materiale Objekte als Bilder usw. haben hingegen einen handfesten Tauschwert.
Brackert: Welche Rolle spielen in diesem eingeschränkten Kommunikationsprozeß die Kunstausstellungen?
Brock: Die klassische Kunstausstellung als Präsentation von Objekten hat im wesentlichen die Funktion, den Zusammenhang zwischen den einzelnen Objekten herzustellen, so daß es möglich wird, das einzelne Objekt abzusichern durch die Bestimmungen, die ihm im Zusammenhang mit anderen zukommen. Und das nicht deswegen, weil etwa ein solcher Zusammenhang tatsächlich gesehen werden sollte, weil also wirklich etwas verstanden werden sollte, sondern weil man die bestehende Unsicherheit reduzieren kann, wenn das einzelne Objekt gestützt wird durch den Hinweis auf seinen angeblich vorhandenen Zusammenhang mit anderen. Ausstellungen sollten also bisher die Weihen historischer Objektivität auf ausgestellte Objekte niedergehen lassen.
Brackert: Verhält sich nicht damit die Kunstausstellung, so wie wir sie bisher gewohnt sind, affirmativ einer ganz bestimmten Entwicklungsstufe der bildenden Kunst gegenüber? Denn es steht ja eigentlich nirgendwo geschrieben, daß sie immer objekthaft sein und bleiben müsse. So daß man beinah sagen könnte, daß die Tatsache, daß wir Kunst primär und fast ausschließlich durch Ausstellungen rezipieren, den Objektcharakter der ästhetischen Realisate überhaupt erst bedingt?
Brock: Die Frage, ob diese Art von Präsentation die Objekte schafft oder ob die Objekte solche Präsentationsform erzwingen, ist nicht so einfach zu beantworten. Es gibt ganz sicher eine Reihe von künstlerischen Produktionen, die den bisherigen klassischen Ausstellungstypus erzwingen. Und es gibt andererseits auch Objekte, die erst durch das Vorhandensein des klassischen Ausstellungsverfahrens erzwungen werden.
Im ersten Fall sind die Künstler für die Kennzeichenbarkeit ihrer Objekte als Kunstwerke darauf angewiesen, daß diese Objekte innerhalb des sozialen Handlungsrahmens Museum oder Ausstellung erscheinen. Sie bedürfen der Institution, um die produzierten Objekte für die Rezeption aufbereiten zu lassen. Die wesentliche Form der Rezeption ist bisher die Aneignung durch Inbesitznahme. Um Aneignung durch Inbesitznahme zu ermöglichen, muß das ausgestellte Objekt als Kunstwerk attributiert werden. Um als Kunstwerk attributiert zu werden, muß das Objekt Ware sein können. Um diese Attributierung als Ware vornehmen zu können, müssen bestimmte Eigenschaften ausgebildet werden; und die Ausbildung dieser Eigenschaften kann bisher noch am besten von Galeristen, Ausstellungsmanagern, Museumsleitern bewerkstelligt werden, auf Grund ihrer subjektiven Fähigkeiten wie auf Grund ihres Apparates. Die Aufbereitung des Objekts als Ware, die durch Inbesitznahme rezipiert werden kann, leistet also das herkömmliche Ausstellungssystem.
Für den zweiten Fall - daß nämlich das Ausstellungssystem bestimmte Objekte erzwingt - läßt sich sagen, daß in ein Großteil dieser Institutionen viel Geld investiert worden ist, das sich amortisieren muß, und daß demzufolge eine optimale Ausnutzung verlangt wird von denen, die diese Investitionen zu rechtfertigen haben, und daß dann natürlich Nachschub produziert werden muß.
Ich halte das aber für gar nicht so bedenklich, wie es normalerweise angesehen wird. Ich glaube, dahinter steckt etwas ganz Realistisches. Nämlich die Tatsache, daß von hundert Künstlern nur vier nach einer Reihe von Jahren schließlich noch im Markt erscheinen mit ihren Produkten. Man kann das Verfahren nicht verkürzen, indem man von Anfang an einfach nur vier Leute produzieren läßt und präsentiert, weil man eben am Anfang nicht weiß, welche die vier von den hundert sein werden. Aus diesem Grund ist auch der Einwand, Museen und Galeristen stellzen heute alles aus und es gebe gar keine Selektionen mehr, hinfällig. Die Funktion des Apparats ist es ja gerade, die Selektion zu einem späteren Zeitpunkt zu ermöglichen, was jetzt heißt: soviel wie möglich durch den Markt zu schleusen.
Brackert: In der herkömmlichen Ausstellungspraxis wird das Kunstwerk normalerweise kommentarlos an die Wand gehängt, zu ästhetischen Gruppen arrangiert. Das heißt: daß nichts zusätzlich geleistet wird, als daß es sichtbar gemacht wird. Kann man einen Zusammenhang zwischen dieser Praxis und der bisher vorherrschenden Auffassung von der Autonomie des Kunstwerks herstellen?
Brock: Das ist eine schwierige Frage, weil sie soviel historische Implikationen hat. Es gibt nämlich zwei große Gattungen von autonomen Kunstwerken: einmal diejenigen, die aus der Anfangszeit der Begründung einer autonomen Kunstpraxis durch den Feudalismus stammen, und dann diejenigen, die das Bürgertum etablierte, nachdem es gesehen hatte, auf welche Weise man mit dem Instrument Kunst, Literatur, Wissenschaft, Philosophie und Musik gesellschaftspolitisch operieren konnte. Das sogenannte bürgerliche autonome Kunstwerk geht davon aus, daß die Bedingungen für das Verstehen, möglicherweise alle Bedingungen für seine Hervorbringung, in dem Werk selbst aufzufinden sind. Wenn das tatsächlich so wäre, dann würde es in der Tat ausreichen, die Objekte auf Grund der immanenten Kriterien ihrer Existenz und ihrer Erscheinung zu rezipieren. Ob allerdings diese immanenten Kriterien dem Werk zu entnehmen sind, wenn man sich ihm an der Museumswand konfrontiert, ist eine andere Frage. Vgl. 'Das sprechende Bild ist da' (in diesem Band, Teil 3.1)
ADORNO zum Beispiel hat sich stets auf diese Autonomie, die bürgerliche Autonomie, des ästhetischen Realisats berufen. Er führte dafür allerdings ganz andere Begründungen an als man normalerweise vermutet. ADORNO hat sich auf die Autonomie des Kunstwerks berufen, weil er verhindern wollte, daß die Probleme anderer gesellschaftlicher Praxisbereiche mit denen der Kunst vermischt werden. Er hat gesagt, daß heute mit den Möglichkeiten der ästhetischen Produktion nicht mehr im Bereich anderer gesellschaftlicher Praxisprobleme operiert werden darf, weil sonst diese Probleme nicht realiter, nicht objektiv gelöst werden, sondern nur auf der Ebene des Scheins, von dem ja die ästhetischen Realisate leben.
Die feudale Begründung der Autonomie des Kunstwerks geht demgegenüber von ontologischen Überlegungen aus. Da wird die Autonomie des Kunstwerks aus der Wesensbestimmung des Kunstwerks abgeleitet, während es im anderen Fall gesellschaftspolitische Bedingungen sind, die die Autonomie des Kunstwerks erzwingen. Zu den Zeiten, als die reale Basis des gesellschaftlichen Lebens nicht wirklich verändert werden konnte, spielte es keine Rolle, ob die Probleme im Bereich der ästhetischen Praxis oder in anderen Praxisbereichen abgehandelt wurden. Damals war, das kann man für die Zeit von 1300 bis heute wohl doch sagen, im Gegenteil die ästhetische Praxis am weitestgehenden in der Lage, die Probleme zu thematisieren. Mit dieser Thematisierung ist es aber dann nicht mehr getan, wenn es eine Möglichkeit gibt, tatsächlich die objektive Basis des Lebens zu verändern. Dann darf diese Thematisierung eben auch nicht mehr im Bereich des Scheins vollzogen werden, sondern dort, wo sich die konkreten Erscheinungen des Lebens manifestieren. Die Aufhebung der Autonomie des Kunstwerks, die heute allgemein gefordert wird, könnte also nur bedeuten, daß man wiederum die realen, wirklichen Probleme in der Ebene des Scheins abhandelt und dort begreifen lernt, wo es doch inzwischen darauf ankäme, sie objektiv zu sehen, und wo es doch inzwischen auch möglich geworden ist, die realen Lebensbedingungen aufzuheben, indem man sie verändert.
Was nun die Ausstellungspraxis anbetrifft, so kann gesagt werden, daß sie weniger durch das autonome Kunstwerk als durch den Zwang zur Verallgemeinerung bestimmt ist. Wenn ein Privatmann das von ihm erworbene Stück seinen in derselben Bezugsgruppe auffindbaren Mitmenschen umstandslos vorführen würde, dann würde es ihm sehr schwerfallen, diese Leute davon zu überzeugen, daß er tatsächlich ein Kunstwerk in Besitz genommen hat. Der Apparat ermöglicht eine Verallgemeinerung im Sinne von Veröffentlichung, eine Entprivatisierung, die aber den Zweck hat, den Privateigentümern im wesentlichen eine Bestärkung ihrer Auffassung zu liefern; möglicherweise auch eine Kontrolle, wobei die Öffentlichkeit da eine Dienstleistung erbringt, die kostenlos zu haben ist. Kostenlos bis auf die Tatsache, daß die Privateigentümer als Leihgeber figurieren. Sie werden dafür normalerweise nicht entschädigt. Das hat seinen guten Grund, daß ein Objekt, wenn es aus einer Ausstellung herauskommt, eben sehr viel weitergehend abgesichert ist als vorher und damit wertvoller wird.
Brackert: Sehen Sie irgendeine Möglichkeit für die Institution Ausstellung, aus diesem letztlich doch nur den Tauschwert des Exponats stützenden Kreislauf herauszukommen?
Brock: Eine Neubestimmung dafür, wie und warum Kunstwerke präsentiert werden sollen, kann sich nur aus der Funktion ergeben, die man dieser Kunst zuweist. Das ist eine entscheidende Differenz zu Überlegungen, wie sie bisher angestellt wurden, die ja doch davon ausgingen, daß diese autonomen oder heteronomen Werke ihren Sinn in sich selbst trügen. Die meisten Aussteller haben es deshalb nie gelernt, Funktionszuweisungen zu entwickeln.
Brackert: An welche Funktionszuweisungen denken Sie?
Brock: Ich würde ausgehen von der Trennung zwischen Produktion und Rezeption und würde die Frage der Funktionszuweisung an die ästhetischen Realisate von der Rezeption abhängig machen, von der Analyse der Bedingungen, unter denen Rezeption stattfindet.
Ein Typ der Ausstellungen, die man generell vielleicht als didaktische bezeichnen könnte, würde also bestimmt durch die Bedingungen, unter denen rezipiert wird: die Bedingungen, unter denen man sieht, unter denen man hört, unter denen man wahrnimmt, empfindet, wobei eben gleichgültig ist, was man sieht und was man empfindet. Daraus könnte sich dann eine Funktionszuweisung an die Kunst ergeben, die lautet: Kunstwerke sollen Rezeptionsformen anbieten, die andere Produkte nicht anbieten.
Aber es kann für uns heute noch nicht gleichgültig sein, ob wir Blumenvasen, Eimer, Natur oder Kunst rezipieren. Und deshalb kommt man mit dieser Funktionszuweisung auch nicht aus.
Wenn man von den historischen Funktionszuweisungen ausgeht, ergeben sich Aufgaben für die Kunst, die erstens: Repräsentation des Selbstverständnisses der Gesellschaft heißen könnten; zweitens: Antizipation, also Entwurf von Vorstellungen, die diese Gesellschaft als zukünftige betreffen, wobei eine dritte Funktion dann darin bestünde, zugleich zu zeigen, warum das Gewünschte nicht erreichbar ist, nicht auf der Stelle realisiert werden kann; also Rationalisierungsleistung der Kunst als Funktion.
Brackert: Können aber nicht gerade diese gesellschaftlichen Entwürfe und Einsichten sehr viel besser von anderen Disziplinen, von der Literatur bis zur Futurologie, geleistet werden?
Brock: Ich glaube auch, daß man mit diesen Funktionszuweisungen in der Kunst heute nicht genug erreichen kann. Man kann aber solche Funktionszuweisungen neu erarbeiten, wenn man von der Frage ausgeht, warum überhaupt diese ästhetischen Realisate rezipiert werden. Von der Seite des Bedürfnisses der Einzelnen her gäbe es die Möglichkeit zu sagen, daß ästhetische Realisate die Möglichkeit der durchgängigen Organisation des Lebens als Zusammenhang aufzeigen, daß sie Kontinuität ausbilden, wo doch heute im Bereich des individuellen Lebens Ereignisse keine Bedeutung im Hinblick auf das Ganze mehr haben, wo selbst schon Autoren oder Künstler 'ohne Biographie' leben, wie BENN gesagt hat. Daraus würde sich die Funktionszuweisung an den Aussteller ergeben, ästhetische Realisate so zu präsentieren, daß sie als Instrumente sichtbar werden. Als Erkenntnismittel. Was soviel heißen würde wie: wenn Du Dich dieser Erkenntnismittel bedienst, dann wird es möglich, die von Dir gewünschte Kontinuität Deines Lebens herzustellen. Über Teilstrecken zunächst und im Training. Dann über weitere Strecken. Auch das hat es ja in der klassischen Kunst gegeben, wenn man zum Beispiel an die Biographie denkt oder an die Porträtmalerei. Womit wir zu einer nächsten Möglichkeit der Funktionszuweisung kommen. Vom subjektiven Bedürfnis der Einzelnen her ließe sich sagen, daß man ihnen ansieht, wissen zu wollen, wer sie sind. Von der Funktionszuweisung her würde das heißen: die Realisate müssen so präsentiert werden, daß sie als Instrumente zur Bestimmung personaler und sozialer Identität gebraucht werden können.
Daß eine ganze Reihe von Künstlern ihre Realisate schon unter diesen Gesichtspunkten produzieren, läßt sich, zumindest was die Environment-Bewegung anbelangt, konstatieren.
Brackert: Bei den Funktionszuweisungen, die Sie vornehmen, fehlt eine, die Arnold GEHLEN damals in den Mittelpunkt seiner Ästhetik stellte: die Entlastungsfunktion. Die Kunst als Freiraum, in dem sich das Individuum von dem auf ihm lastenden Sozialdruck erholen kann. Halten Sie diese Funktionszuweisung für legitim, für zutreffend?
Brock: Nein. Das ist eine klassische, bürgerliche, die davon ausgeht, daß Kunst womöglich im Spiel sei und daß die objektiven Zwänge im Bereich der Kunstproduktion und -rezeption geringer seien als in anderen Praxisbereichen. Was sich ja doch nun inzwischen jedermann als Irrtum dargestellt hat. Die Zwänge sind die gleichen. Der Grad der Entfremdung des künstlerischen Produzenten von seinem Produkt ist der gleiche wie der eines Schreiners von dem von ihm hergestellten Produkt. Entlastend kann die Kunst in dem Augenblick nicht mehr sein. Was ja auch ein Großteil des Publikums bei der Konfrontation mit ästhetischen Realisaten heute so irritiert. Er geht noch aus auf Entlastung, auf Freiraum, auf Aufhebung der Misere für einen bestimmten Zeitraum und an einem bestimmten sozialen Ort, und erfährt eigentlich nur, daß diese Erwartung nicht erfüllt wird. Das ist die notwendige Konsequenz der tatsächlichen Bedingungen, unter denen heute ästhetisch produziert wird.
Ich würde eher das Gegenteil meinen: nämlich daß man sich heute als Postbeamter oder als Schreiner verhältnismäßig viele Freiräume schaffen kann, viele Entlastungen zulegen kann, die einem Künstler überhaupt nicht mehr möglich sind. Ich würde meinen, daß es unter diesen Bedingungen sogar gerechtfertigt ist zu sagen, daß der höchste Grad an Zwanghaftigkeit und Entfremdung sich im Bereich des wissenschaftlich-künstlerischen Arbeitens äußert. So daß die ihre Feierabend-Aktivität suchenden Betrachter von Kunstwerken im Grunde darauf verwiesen werden, daß sie, wenn sie sich den ästhetischen Realisaten stellen, noch einmal, womöglich sogar vermehrt, Arbeit zu leisten haben. Weshalb der Laienstandpunkt im Bereich der ästhetischen Praxis immer haltloser wird und die Professionalisierung in diesem Gebiet immer mehr zunimmt. Es gibt keine Liebhaber der Kunst mehr, weil die Möglichkeit, als Rezipient sich ihr anzunähern, eine Arbeitsleistung verlangt, die normalerweise einen Tagesablauf so hochgradig bestimmen müßte, wie wenn man am Fließband stünde und gezwungen wäre, bestimmte Leistungen zu erbringen.
Brackert: Wenn das so ist, wenn also die herkömmliche und bis heute dominierende Haltung des privaten 'Mögens' oder 'Nichtmögens' den Realisaten, vor denen eine solche Entscheidung getroffen wird, nicht im entferntesten mehr gerecht werden kann - müßte dann nicht im Grunde unser Ausstellungswesen radikal verändert werden? Denn wir tun ja doch gar nichts dafür, daß der sogenannte Laie kein Laie bleibt. Oder heißt das, daß der Kreis derer, die Realisate aus dem Bereich der ästhetischen Praxis nun tatsächlich noch rezipieren können, so schmal wird, so schmal werden muß, so schmal werden soll, daß im Vergleich dazu die bisherige bildungsbürgerliche Schicht der an der Kunst auf diese oder jene Weise Partizipierenden noch eine Volksbewegung war?
Brock: Man muß natürlich fordern, daß die Aussteller sich bemühen, das Laienpublikum zu einem professionellen Publikum auszubilden. Und dem liegt ja auch meine Vorstellung von der Besucherschule zugrunde, wobei betont wird: Schule und Ausbildung und Zwang. Es gibt keine Möglichkeit, in diesen wie in anderen Bereichen, vom "Fröhlichen Lernen" zu sprechen, vom "Etwas-nebenbei-Tun" und "Unter-der-Hand-Mitbekommen". Es ist ja abenteuerlich, Leute, die tagtäglich Straßenbahnen und Flugzeuge mit der größten Selbstverständlichkeit benutzen, vor einem ästhetischen Realisat stehen zu sehen mit dem Anspruch, das habe sich ihnen jetzt zu erschließen. Wenn solche Leute in ihrem Flugzeug diesen Anspruch auch stellen würden, dann würde der Pilot anfangen müssen, ihnen zu erklären, was Induktionsstrom ist und was Widerstand ist und was Ampere ist, und es bliebe den Leuten dann nur übrig, darauf zu verzichten, mit dem Flugzeug zu fliegen oder mit der Straßenbahn zu fahren. Im Bereich der Kunst vermeint aber jedermann, mehr oder weniger nebenher diese Bedingungen zu erfüllen.
Brackert: Ließe sich der Vergleich mit dem Flugzeug nicht auch anders ausdeuten? Wir alle wissen nicht, wie ein Flugzeug funktioniert, aber wir benutzen es. Und genauso - nämlich in dem Maße, wie es ihm möglich und komfortabel ist - benutzt der Betrachter einer Kunstausstellung das Kunstwerk.
Brock: Ja, aber dann muß er es als Instrument verstehen, wie ein Flugzeug auch. Das heißt, bevor er es benutzt, muß er wissen, was er damit tun will. Wenn ein Betrachter das weiß, wenn er also, bevor er in ein Museum, in eine Ausstellung geht, weiß, was er dort tun will, was er wissen will, erlernen will - dann gibt es für ihn auch keine Probleme. Dann ist es möglich, daß sich jemand tatsächlich darauf beschränkt zu sagen: ich möchte halt genießen. Und dann wird er auch auf seine Kosten kommen. Für solche Leute ist die Problematisierung der herkömmlichen Ausstellungspraxis gar nicht gegeben.
Nur, das Problem ist, daß die Leute eben nicht wissen, was sie wollen, wenn sie Kunstwerke rezipieren.
Die Ausstellungsinstitute können meiner Meinung nach nur noch als Schulen existieren. Als Ausbildungsstätten, in denen mit einem ganz speziellen, für bestimmte Leistungen brauchbaren Instrument als Resultat gesellschaftlicher Arbeit vorgegangen wird. So wie man Techniker-Schulen besucht, wird man sich dort also auf schulische Ausbildung einlassen müssen, indem man sich zur Erreichung eines bestimmten Zwecks des Instruments der Kunst bedient. Wie etwa des Zwecks, Kontinuitätsausbildung zu betreiben für sein eigenes Leben, den Fragen der personalen und sozialen Identität auf die Spur zu kommen. Und da muß zumindest der gleiche Aufwand an Arbeit verlangt werden, wie ihn jeder Bürger auch im Hinblick auf die Bedienung eines Automobils aufzubringen willens ist.
Brackert: Sehen Sie im derzeitigen Kunstbetrieb irgendwo Ansätze in dieser Richtung?
Brock: Bisher gibt es nur eine Andeutung davon, insofern als sich mehr und mehr Leute für den Typ der didaktischen Ausstellung entscheiden. Darüber hinaus scheint es so etwas nicht zu geben, wird es so etwas auch in absehbarer Zeit nicht geben können. Das erste wäre nämlich, daß man eine ganz andere Gruppe von Leuten beauftragt, Ausstellungen zu machen, als die, die es bisher gemacht haben. Ich könnte mir vorstellen, daß etwa Systemtheoretiker oder Kybernetiker, die die Frage der Komplexität von Systemen auf einer anderen Ebene ihren Studenten oder Mitarbeitern klar machen wollen, in die Museen gehen, um dort an Hand der ästhetischen Realisate die Differenz zwischen Komplexität und Ordnung darzustellen. Wobei sie dann zwangsläufig darauf kämen, daß ästhetische Realisate bestens dazu geeignet sind, den Komplexitätsgrad eines Systems zu erhöhen. Da die Erhöhung der Komplexität eine notwendige Forderung an gesellschaftliche Prozesse ist, ergäbe sich von daher eine Funktion für die Kunst, die auf der höchsten Ebene der Argumentation im Bereich der Naturwissenschaften abgesichert wäre.
Brackert: Von der Forderung der Arbeitsleistung vor dem ästhetischen Realisat her müßten Sie eigentlich unseren ganzen gegenwärtigen Kunstbetrieb, den ja die Ausstellungen an vorderster Front in Bewegung halten, als eine Scheinblüte abqualifizieren. Würden Sie angesichts des vorhin konstatierten Publikumsinteresses so weit gehen wollen?
Brock: Das ist ganz sicher eine Scheinblüte, die als wirklich und bedeutend nur dadurch erscheinen kann, daß ökonomische, reale Bedingungen hinter ihr stehen: also der Tauschwert, den das ästhetische Realisat hat. Die Bedeutung des Tauschwerts eines Objekts ermöglicht es den meisten Rezipienten, von der Rezeption des Gebrauchswerts völlig abzusehen. Wenn es relativ gleichgültig ist, welchen Gebrauchswert die Sache hat, weil über den Tauschwert ihre Wichtigkeit in jedem Fall demonstriert werden kann, dann ist es nicht verwunderlich, daß die meisten sich nicht gedrängt fühlen, die dafür notwendige Arbeit zu leisten. Eine Scheinblüte ist es zumindest solange, als das enorme Anwachsen des Tauschwerts von künstlerischen Objekten gesichert ist. Dafür dürfte das Verwertungssystem, der Handel also, noch sehr lange sorgen. Am Beispiel der concept-art hat man ja sehen können: wenn künstlerische Projekte keinen Tauschwert ausbilden können, erscheinen sie gar nicht im Markt, und das heißt auch: nicht in der Rezeption - zumindest nicht in dem Maß, wie es nötig wäre. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, daß die Bedeutung von Museen und Ausstellungsinstituten in Zukunft eben darin liegen wird, den Gebrauchswert der ästhetischen Realisate wieder zu entdecken und über ihn mit dem Publikum zu kommunizieren.
Brackert: So lange es sich dabei um Objekte handelt, die auch im Handel erscheinen oder zumindest handelbar sind, ist es natürlich auch dann schwer zu entscheiden, wer da wen stützt …
Brock: Da sehen Sie, daß der Rückschlag schon gekommen ist: die meisten Privateigner leihen ihre Objekte nicht mehr für Ausstellungen aus, wenn damit irgendwelche Tendenzen verbunden sind, die auf Abbau des Tauschwertes ausgehen. Das wird den Privateignern auch schon dadurch nahegelegt, daß die Ausstellungsinstitute oft nicht mehr in der Lage sind, die horrenden Versicherungssummen aufzubringen…
Brackert: Aber bis heute klappt das System doch eigentlich noch ganz gut …
Brock: Nur da, wo eindeutig auf dem Kunstcharakter der Realisate bestanden wird, das heißt: auf ihrem Warencharakter, das heißt: auf ihrem Tauschwert. Wer auf Gebrauchswert besteht, wer den Erkenntniswert ästhetischer Realisate nutzen will, wird von dem gegenwärtigen System kaum bedient.