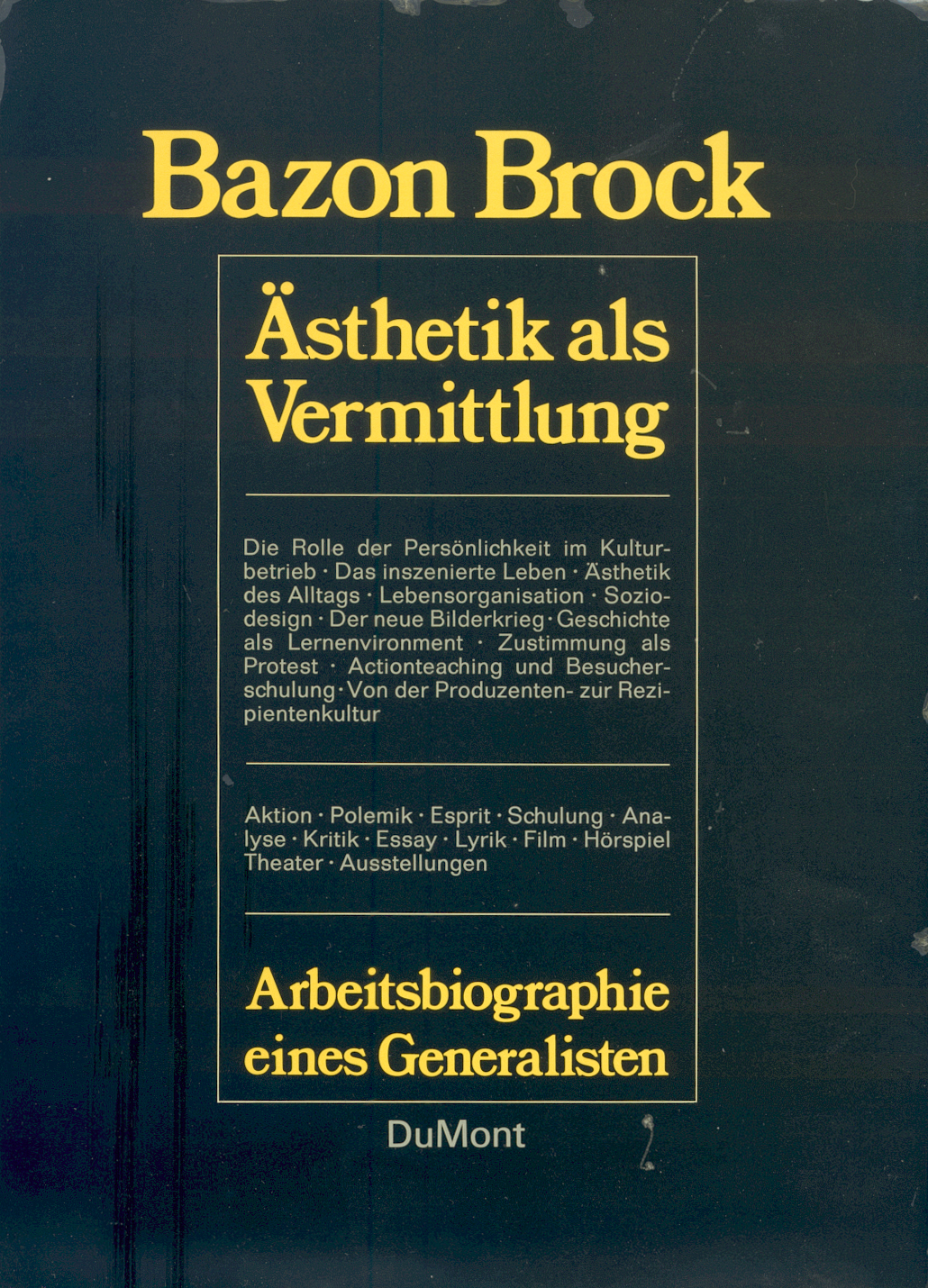Geschrieben März 1976 für H. v. NUSSBAUM u.a. (Hrsg.): ‚Die verordnete Krankheit‘, Fischer-Verlag, Frankfurt am Main 1977. Die Erfahrungen gehen zurück auf eine Erkrankung vom Oktober 1974 bis März 1975.
Als ich das Krankenhaus verließ, hielten mich meine Freunde nunmehr tatsächlich für krank. Ich hatte ihnen nämlich gesagt, daß ich jetzt fest entschlossen sei, meine Ärzte zu lieben. Das erschien ihnen völlig unverständlich, nachdem sie durch zahlreiche Besuche am Krankenbett mitbekommen hatten, wie schwer es mir gefallen war, meine Ärzte zu verstehen. Ich konnte zum Beispiel nicht verstehen, als mir ein Arzt auf meine Frage, warum ich drei verschiedene Angaben zur Längendifferenz meiner Beine erhalten hätte, sagte: "Das hängt eben davon ab, wie man mißt." Mir schien klar, daß man zur gleichen Längendifferenz kommen muß, ob man nun in Zoll, cm oder inches mißt, vorausgesetzt daß der Patient, was bei mir der Fall war, bei der Vermessung immer die gleiche Stellung einnimmt. Ich konnte nicht verstehen, daß man mir nach einem kleinen Zwischenfall Marcomar gab, wodurch über Molekularumbau die Blutgerinnungsfähigkeit reduziert wird, ich aber zugleich zu Mittag Spinat serviert bekam, der diesen Effekt wieder aufhebt. Ich konnte nicht verstehen, warum man, wenn man auf Desinfektion im Krankenzimmer einer chirurgischen Station einen gewissen Wert legt, als Desinfektionsmaßnahme vor allem das Lüften der Matratzen bei Patientenwechsel anzubieten hat, und warum die Putzfrauen mit ihren Wischtüchern Fußboden und Patiententischchen gleichermaßen bearbeiten und dann im Patientenwaschbecken Wischtuch und Eimer reinigen. Meine diesbezügliche Frage stieß auf völliges Unverständnis und den nachdrücklichen Hinweis darauf, daß ich merkwürdige Ansichten hätte. Ich konnte nicht verstehen, daß man mir sagte, nur der Chirurg könne in einer bestimmten Sache Auskunft geben, dieser sich aber als nicht zuständig erklärte. Ich konnte nicht verstehen, daß man frisch Operierte mit ihren Betten schwungvoll in Fahrstühle bugsierte, deren Fußbodenniveau gut drei Zentimeter über dem Etagenboden stand. (Diese Fahrstühle wurden ausschließlich zu besagtem Zweck verwendet.) Als ich darum bat, mich nicht wie die von mir beobachteten Vorgänger solchen Erschütterungen auszusetzen, wurde ich wegen meiner Extra-Wurst-Wünsche streng getadelt. Nach drei Wochen war der Fahrstuhldefekt immer noch nicht behoben, man gab mir klipp und klar zu verstehen, daß „das Ding immer kaputt sei“, daß man sich inzwischen daran gewöhnt habe; was allerdings nicht hieß, daß man die Betten über den Niveauunterschied hinweghob.
Zu lieben, wo man nicht verstehen kann, bleibt die letzte Form der Demonstration von Lebendigkeit und aktiver Teilnahme an einem Geschehen, dessen nicht unwesentlicher Bestandteil man selber ist. So zu lieben, bedeutet für einen Menschen einen letzten Widerstand dagegen, sich selbst nur noch als Opfer zu sehen. Aber diese Liebe aus Notwehr hat kaum Chancen, ihr Ziel zu erreichen, weil die Beteiligten durchaus spüren, daß diese Liebe erpresserische und terroristische Züge trägt, daß sie auf Festlegungen, ja auf Fesselung derer hinausläuft, die das Objekt solcher letzten Liebe sind.
Wie sich solche Liebe zu meinen Ärzten äußerte? Nun, so, wie sich alle verzweifelte Liebe zeigt, nämlich mit der Bereitschaft, sich selbst zum Objekt zu deklarieren, indem man sich an das Verhalten und die Erwartungen des Arztes völlig anpaßt mit der Hoffnung, er würde der Peinlichkeit einer solchen Unterwerfung zu entgehen suchen, indem er seinerseits bereit wäre, sich den Erwartungen des Patienten anzubequemen. Das Optimum einer solchen Erfüllung der Patientenerwartung ist dann erreicht, wenn der Arzt dem Patienten mit größter Selbstverständlichkeit eingesteht, daß er sich geirrt habe bzw. daß er die Grenzen seiner Kompetenz durchaus kenne. Das vielberufene Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient besteht ausschließlich in der Annahme des Patienten, daß der Arzt beständig mit der Möglichkeit rechne, sich zu irren und für einen solchen Fall Vorsorge zu treffen, indem er alternative Lösungen des Problems ins Auge fasse. Im Normalfall nimmt der Patient an, daß der Arzt durch seine Erfahrung auch unausgesprochenermaßen, gleichsam als Verfahren der Diagnose und Therapie selber, in solchen Alternativen denke. Diese als normal anzunehmende Gegebenheit ist sehr viel seltener anzutreffen als man glaubt, bevor man selber ausgiebige Erfahrungen gemacht hat. Das Denken in Alternativen ist außerordentlich zeitraubend und risikoreich für den einzelnen Arzt, weil er sich dadurch in seinem Wissen und in seinen Fähigkeiten beständig selbst in Frage stellen muß. Da das Ärzte (wie andere Menschen in ihren Berufsrollen) zu vermeiden wünschen, verlagern sie im günstigsten Falle die Problematisierung ihrer eigenen Fähigkeiten auf die Problematisierung ihres Metiers. Da man aber schlecht handeln kann, wenn man zwar nicht sich selbst, aber die Verfahren der Berufsausübung und die Rationalität der im Metier liegenden Auffassungen und Anschauungen in Dauerreflexion hält, greifen die Ärzte wie andere Professionen auch nur allzu leicht auf die entlastende Funktion von Dogmen und Ritualisierung zurück.
Ein außerordentlich vielsagendes, weil an simplen Sachverhalten festgemachtes Beispiel: Jahrzehntelang bestand das Dogma, Brandwunden auf keinen Fall mit Wasser in Berührung kommen zu lassen. Ziemlich überraschend verkündete und praktizierte man dann das Gegenteil, ohne sich selbst oder gar den Patienten eine Erklärung dafür zu geben, wie es dann gegenüber einem so simplen, der Empirie ohne weiteres zugänglichen Tatbestand zu einem solchen Sinneswandel kommen konnte. Ich erinnere mich noch deutlich, daß meine Mutter von einem Hautarzt mit er Androhung maltraitiert wurde, sie würde den Haftpflichtschutz verlieren, weil sie nach einem Arbeitsunfall mit Verbrennung als Folge sich selbst verstümmelt habe, indem sie gegen die telefonische Anweisung des Arztes die Verbrennungen mit eiskaltem Brunnenwasser behandelte.
Ein Patient versteht sehr gut, daß es über medizinische Sachverhalte wie über alle anderen kontroverse Auffassungen gibt. Er versteht nicht, daß ausgerechnet Ärzte diese Grundvoraussetzung menschlichen Handelns derart außer acht lassen, daß sie Patienten, die völlig selbstverständlich derartige Meinungskontroversen voraussetzen, in Aporien jagen.
Das gegenwärtig typischste Beispiel für derartige Aporien: Ich habe selbst gehört, wie mir zudem noch befreundete Ärzte eine Patientin als hysterische Ziege bezeichneten, weil sie wegen einer kleinen Auffälligkeit auf der Haut in die Praxis gekommen war, um die Doktoren zu befragen, ob diese Veränderung Anlaß zur Besorgnis gebe. Die Patientin hatte nämlich in einem Merkblatt für Krebsvorsorge gelesen, daß man den Arzt aufsuchen solle, wenn man beispielsweise eine solche Auffälligkeit an sich beobachte, wie sie bei der Patientin vorlag. Die Aporie besteht darin, mit dem ganzen Nachdruck medizinischer Autorität dem Patienten zu sagen, daß die Heilungschancen bei Krebs um so größer seien, je früher die Erkrankung entdeckt werde, ja, daß es in der Natur dieser Erkrankung läge, erhebliche Symptome erst zu zeigen, wenn die Erkrankung bereits fortgeschritten ist. Wenn aber Patienten, durch diese 'Aufklärung' veranlaßt, in die Praxen strömen, dann werden sie im wohl nicht seltenen Fall als Hypochonder abgestempelt. Zudem stellt sich heraus, daß die überwiegende Zahl der Ärzte selber gar nicht in der Lage ist, aufgrund ihrer Ausbildung und Erfahrung jene Symptome zu bewerten, die dem Laien durch die 'Aufklärung' als ernstzunehmende Abweichung bezeichnet werden. Diese eigene Inkompetenz versucht der Arzt, und das ist völlig verständlich, zu verbergen, indem er zu offiziell anerkannten Diagnosen greift, die gerade den im einzelnen nicht aufklärbaren Verhaltens- und Symptomäußerungen des Patienten gelten, also zum Beispiel zur Diagnose 'psychovegetative Dystonie'. Diese Scheindiagnosen, die nichts anderes als beliebige Benennungen sind, stellen für den Arzt einen Placebo-Effekt bei der Aufrechterhaltung seines Selbstwertgefühls dar.
So wäre ich außerordentlich überzeugt gewesen von der wissenschaftlichen und praktischen Qualifikation jener Spezial-Ärzte, die mir als Diagnose die Auskunft gegeben haben 'nicht-geklärte Rückenschmerzen', wenn ich nicht durchaus eindeutig diagnostizierbare Rückenschmerzen gehabt hätte. Selbst die Tatsache, daß ich, wie die Ärzte sehr wohl sahen, vor Schmerzen in Rücken und linkem Bein nicht einmal während der Untersuchung stillsitzen oder -stehen konnte, veranlaßte sie nicht, meine Symptome als das zu nehmen, als was sie dann auch von anderen Ärzten genommen wurden, nämlich als Hinweis auf die Möglichkeit eines Bandscheibenvorfalls, sondern ließ sie vermuten, daß die ihnen von mir präsentierten Persönlichkeitsäußerungen wohl einer psychologischen Diagnose bedürften. Diese Ärzte hielten sich für außerordentlich fortschrittlich, weil sie psychosomatische Zusammenhänge in Erwägung zogen. Ich mußte mich deshalb der deutschen Version des MMPI-Tests unterziehen. Diesen speziellen Test anzuwenden, bedeutet für die Diagnose nur eine Verlagerung der Problematik, wenn er nicht gar, was anzunehmen ist, in der Mehrzahl der Fälle zu völlig unbrauchbaren Aussagen über die psychische Verfaßtheit des Patienten führt. Auf den ersten Blick zeigte die deutsche Version totale Schwachsinnigkeiten allein schon aufgrund unzähliger Übersetzungsfehler, geschweige denn der fragwürdigen Benutzung von kulturellen Mustern, die aus einer nordamerikanischen Mittelstandsgesellschaft auf unsere Verhältnisse übertragen wurden. Genau damit aber wird die dem Test zugrundeliegende Annahme von den die psychische und damit körperliche Verfaßtheit des Patienten beeinflussenden Umweltfaktoren außer Kraft gesetzt.
Daß Ärzte wie andere Berufsrollenträger Schwierigkeiten mit der Einschätzung von Verfahren haben, die aus anderen als ihren Spezialbereichen übernommen wurden, leuchtet ein. Ich kann nicht sagen, wieweit Evaluierung der Verfahren unter wissenschaftstheoretischen Gesichtspunkten überhaupt zur Ausbildung von Medizinern gehört. Daß aber auch erfahrene Kliniker für die von ihnen täglich eingesetzten therapeutischen Maßnahmen kaum theoretische Begründungen zur Verfügung haben, berührt merkwürdig. Die wissenschaftliche Fortbildung scheint sich häufig auf das flüchtige Lesen der von der Pharmacie verfaßten Gebrauchsanweisungen für Medikamente und auf deren Äquivalente in den Fachzeitschriften zu beschränken. In dieser Lage, die wohl in einer Hinsicht auch nicht von den individuellen Fähigkeiten der Betroffenen abhängt, nämlich im Hinblick auf die Verarbeitung einer Flut von Informationen, die ohnehin zweifelhaft sind, sollten Ärzte, die sich ausschließlich auf ihre Erfahrungen verlassen, größtes Vertrauen genießen. Solche Einschränkung auf Empirie wird aber andererseits vom akademisch ausgebildeten Arzt, speziell dem Facharzt, als eine Art unwissenschaftlicher Begründung der Berufsausübung disqualifiziert. Denn mit der Begründung in der Empirie, in der Erfahrung können auch nichtakademisch ausgebildete Heilpraktiker Vertrauen für sich beanspruchen. Der Allgemeinmediziner, der wohl über das entschiedenste Maß an Kenntnis und Erfahrung verfügen muß, erhält mit einer gewissen Folgerichtigkeit innerhalb der Berufshierarchie der Ärzteschaft den geringsten Status zugewiesen. Es ist ja sicher nicht den kaufmännischen Interessen der Krankenhausärzte zuzuschreiben, daß sie als Spezialisten die dem Patienten mitgegebenen Daten und Diagnosen der Allgemeinmediziner so wenig ernst nehmen, daß sie bei der Einweisung so tun, als ob es sie gar nicht gebe.
So löblich es auch ist, daß der Facharzt vor sich selbst seinen Anspruch auf wissenschaftliches Denken zugunsten des Erfahrungswissens aufgibt, so zweifelhaft bleibt die Aufrechterhaltung dieses Anspruchs vor dem Patienten und vor der Gesellschaft. Die Synthese beider Positionen ist der allerorts und jederzeit von Ärzten vorgebrachte Ausspruch: „Die Ärzte sind auch bloß Menschen“; als ob irgend jemand, außer den Ärzten selber, je anderes angenommen hätte. Das belegt zum Beispiel die KOCH-Studie aus dem Jahr 1972. Wenn Ärzte dagegen einwenden, erst die Patienten würden sie Rolle eines Übervaters drängen, so verschieben sie Ursache und Wirkung. Denn wenn Ärzte auf die Mitarbeit des Patienten keinen Wert legen, weil sie ohnehin besser wüßten als er, was ihm fehlt, wenn sie ihre Berufsautorität als unanfechtbare Voraussetzung für die Ausübung des Berufs hinstellen, dann erwecken sie in dem Patienten, der von ihnen durch sein Leiden total abhängig ist, eben genau jene Einschätzung des Arztes, die die Ärzte als ihnen fremde Zuschreibung darstellen, auf die sie notgedrungenerweise sich einlassen müßten, um den armen Patienten nicht zu enttäuschen. Kein vernünftiger Mensch wird in den Ärzten etwas anderes sehen als Menschen, die nach bestem Wissen und Können ihren Beruf ausüben. Genau diese Einschätzung lassen die Ärzte nicht zu, wenn sie, soweit man Versicherungsstatistiken Glauben schenken kann, sehr viel weniger Kunstfehler begehen als andere Berufsausübende – also doch mehr als bloß Menschen sind? Wofür die geringe Anzahl eingestandener Kunstfehler tatsächlich spricht, weiß jedes Kind, am allerbesten wissen das die Ärzte selber – von jeweils anderen Ärzten.
Am entschiedensten wehren sich die Ärzten dagegen, daß man sie auch bloß für Menschen hält, indem sie für ihre Arbeit eine Entschädigung in Anspruch nehmen, wie sie keine andere Berufsgruppe, die Unternehmer eingeschlossen, für sich in Anspruch nehmen kann. Es gäbe sicherlich keinerlei Diskussionen, wie sie gegenwärtig im Zusammenhang mit unserem Gesundheitswesen auch den Ärzten gegenüber geführt werden, wenn dieser entscheidende Hinweis auf die Besonderheit des Arztstandes, nämlich das unvergleichlich hohe Einkommen für durchaus vergleichbare Arbeit und ohne jede Leistungskontrolle der Grundlagen entbehrte. Angeblich sind wir eine Leistungsgesellschaft, und gerade die Ärzte bestehen darauf, für Leistung entschädigt zu werden. Man kann es aber nicht als Leistungsnachweis betrachten, daß ein Arzt bis zu 16 Stunden täglich seine Praxis besetzt hält; eine Leistung wäre ja wohl nur über den Erfolg der ärztlichen Bemühungen festzustellen. Eine derartige Leistungsmessung ist bisher nicht bekannt. Anzunehmen, daß diese Leistungen erbracht würden, weil immer wieder Patienten zu den Ärzten gingen, ist ja wohl absurd.
Weder auf der wissenschaftlichen noch auf der gesellschaftspraktischen Seite der Erörterung der ärztlichen Tätigkeit lassen sich die Ärzte an ihrem nur von ihnen selbst vorgetragenen Berufsethos messen. Die Konsequenz kann aber nicht lauten, daß dieses Berufsethos abgeschafft werden müßte, sondern im Gegenteil, daß es größere Verbindlichkeit erhält. Demzufolge muß Kritik an einer Vielzahl ärztlicher Praktiken darin einmünden, daß man der Öffentlichkeit, den potentiellen Patienten wie den akut Kranken, dieses ärztliche Selbstverständnis und Ethos verfügbar macht, ja es ihnen geradezu einhämmert, damit die Betroffenen in die Lage versetzt werden, die Ärzte mit ihrem Selbstverständnis im konkreten Fall zu konfrontieren. Denn eine noch größere Katastrophe für den Einzelnen wie für die Gesellschaft als Ärzte mit einem uneingelösten Ethos sind Ärzte völlig ohne Berufsethos. So habe ich von einem mir allerdings befreundeten Arzt nach langer Erörterung der eklatanten Widersprüche zwischen seinem beruflichen Selbstbild und der beruflichen Praxis zugestanden bekommen, daß er sich um diese Widersprüche eigentlich schon lange keine Sorgen mehr zu machen brauche, weil er gar kein Ethos mehr habe, er sei sozusagen ein ärztlicher Atheist, der allerdings für jeden von ihm seiner eigenen Meinung nach begangenen Kunstfehler einzustehen bereit sei (d.h. seine Versicherung zahlen lasse). Unter letzterer Bedingung, sollte sie eingehalten werden, wäre sogar ein medizinischer Atheist ein gottgesegneter Mann.
Ich habe bei vielen von herzlichem Lachen begleiteten Erörterungen mit Medizinern immer wieder zu hören bekommen, daß schließlich nicht sie selber für den ihnen manchmal unangenehmen Stand der gegenwärtigen medizinischen Praxis verantwortlich seien. Vielmehr sei so von ungefähr, und sie wüßten gar nicht so recht, wie, durch eine Umstellung der Bewertungsmaßstäbe ein derartiger Geldsegen aufs Konto geschneit. Wenn beispielsweise das Anstellen technischer Geräte, das Verschreiben von Pillen und ähnliche Tätigkeiten höher bewertet würden als die genuine ärztliche Leistung, sich um einen Kranken zu bemühen oder sich fortzubilden, dann hätte das die fatale Folge, daß selbst junge Ärzte, die mit der gegenwärtigen Praxis nicht einverstanden sind, sich ihr über kurz oder lang anpassen müßten. Gegen die berufsständische Bevormundung, im übrigen ein mittelalterliches Relikt der Zukunftsgesellschaft, gegen die Bewertungspraxis der Verrechnungsstellen, gegen die Pharmacie und die leider nun einmal so verfahrene Situation im Krankenhauswesen komme man als Einzelner nicht an.
Diese Verlagerung der Verantwortung auf das 'System' betreiben keineswegs nur an seiner Aufrechterhaltung möglicherweise interessierte Ärzte, sondern vor allem die Kritiker dieses Systems. In sozialistischen Gesellschaften könnte im übrigen genau die gleiche Kritik am System geübt werden wie hier, obwohl nicht schlank heraus Profitinteressen den Ansatzpunkt einer Kritik am System darstellen. Ich glaube nicht, daß mit einem Umbau des Systems der medizinischen Versorgung wesentliche Verbesserungen für den Patienten erreicht werden könnten, ganz im Gegenteil. Veränderungen zum Besseren können sich allein daraus ergeben, daß das Abschieben der Kritik aufs System, auf anonyme Strukturen nicht mehr anerkannt wird, wo es bisher geradezu als Ausweis der Kritikbefähigung galt, nicht Personen, sondern das System für offensichtliche Unzulänglichkeiten zu attackieren.
Ich habe auf Stationen, deren Fürsorge ich mir angedeihen lassen durfte, in einer Unzahl von Einzelheiten erfahren, daß alles Personal unterhalb des Oberarztes immer wieder darauf verwies, daß es für nichts verantwortlich sei, was die Tagespraxis kritisch werden läßt, weil die Verantwortung eben bei diesem einen Manne läge. Der aber könne, und das ist evident, sich gar nicht um die Einhaltung der vielleicht ganz sinnvollen Anweisungen kümmern, so daß sich eine graue Zone des Lavierens zwischen Rückzug auf unsichtbare Autorität und andererseits beachtlicher Willkür der angeblich Kompetenzlosen entwickelt. Wenn das de facto der Fall ist, juristische Konsequenzen ohnehin nur in den allerseltensten Fällen zur Debatte stehen, warum verpflichtet man dann nicht Pfleger und Schwestern zur Eigenverantwortlichkeit, in der sie besser kontrollierbar sind denn als Vollzugsorgane eines obersten Willens, der sich nicht mehr manifestiert? Zudem erfährt man täglich, daß ganz entscheidende Leistungen für den Patienten gerade von Pflegern und Schwestern erbracht werden. Von der Seite der Leistungen für den Kranken müßten Pfleger, Schwestern und Ärzte völlig gleichgestellt sein, wenn man schon das Argument der Ärzte gelten läßt, die Stundenzahl ihrer Bemühungen sei als Leistung zu bewerten. Es ist ganz offensichtlich, daß nicht die für den Patienten erbrachten Leistungen Maßstab für Entschädigungen der Ärzte sind.
Im übrigen: Es ist doch wohl nicht das System der medizinischen Versorgung, das meinen Orthopäden zwang, mir eine volle Konsultation zum zehnfachen kleinsten gemeinsamen Nenner namens Adgo zu liquidieren, bloß weil ich ihm telefonisch mitgeteilt hatte, wie die Diagnose des Neuroröntgenologen lautete. Es ist doch wohl nicht das System, das meinen Internisten zwang, die Erörterung einer von ihm selbst so genannten schwierigen Sachlage nach zehn Minuten abzubrechen, weil draußen Dutzende von Patienten warteten, denn er war der einzige Arzt, den es im weiten Umkreis auf plattem Land noch gab; die werten Kollegen hatten sich aus lauter Systemzwang in die Großstädte begeben. Und schließlich war es nicht der Zwang des Systems, der meinen Chirurgen veranlaßte, mich einen Perfektionisten zu schelten, weil ich darum bat, die Kuhle in meinem Frischoperierten-Bett mit einem Laken ausstopfen zu lassen, damit nicht nur die von der Operation betroffenen Wirbelsäulenteile, sondern auch Brust- und Halswirbel halbwegs normal gelagert werden könnten. Ich darf dennoch sagen, daß ich sie alle liebe, zumal die Kuhle schließlich ausgestopft wurde - mit zwei Laken.