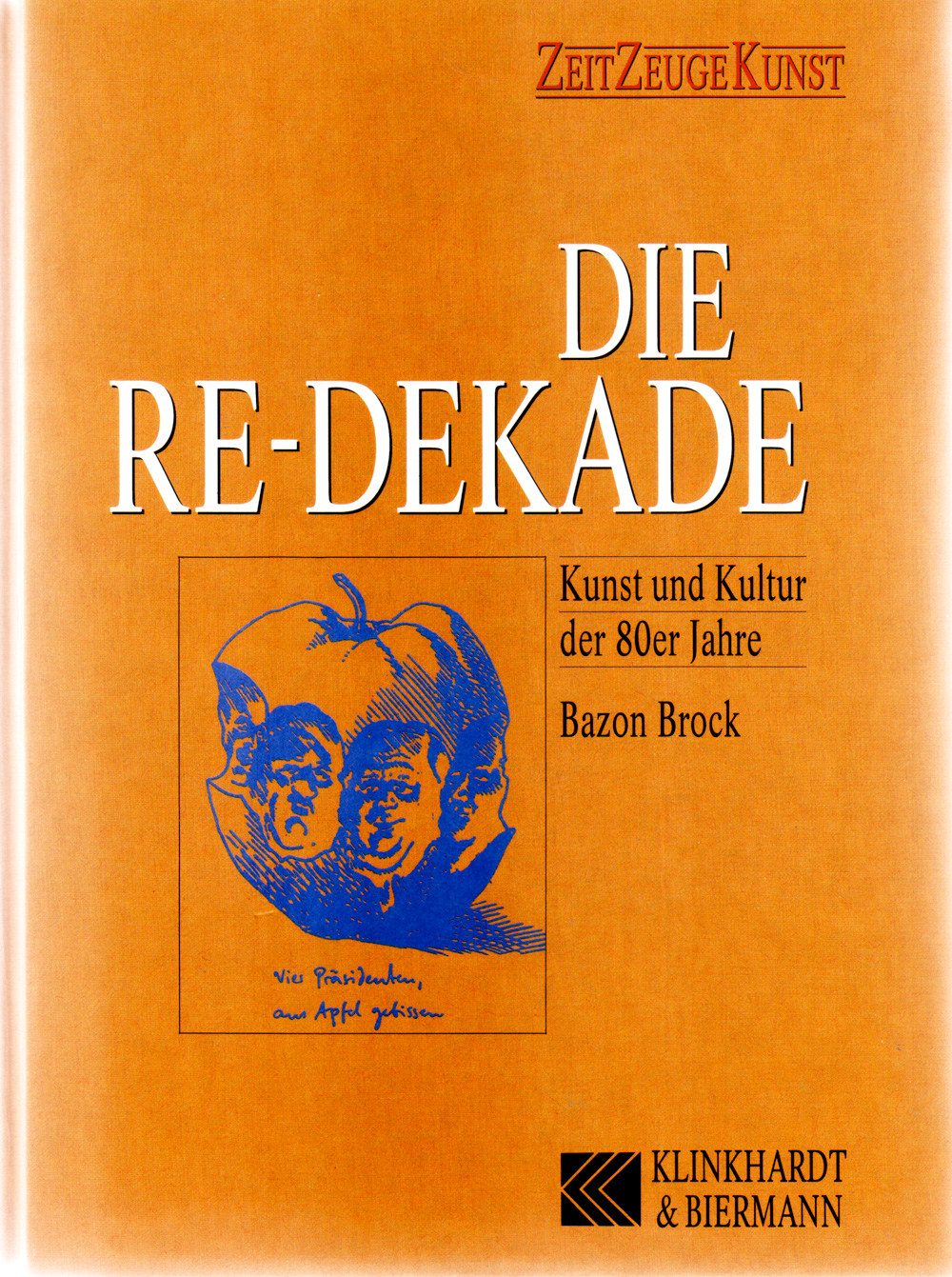Trutz Graf von Kerssenbrock verzichtete auf den Doktortitel, bevor man ihm – mit unangenehmen strafrechtlichen Folgen – diesen Titel ohnehin aberkannt hätte, so war zu lesen.
„Nebbich“, hämten die einen, „Graf ist ja immer noch Status genug!“ „Eine auch die Usancen der Wissenschaft entlarvende Niedertracht“, meinten die anderen. „Da haben Neider und politische Gegner nachgetreten, um den Kerssenbrock zu erledigen. Wie steht der jetzt da? So eine Statusdegradierung ist tödlich durch das Bewußtsein des Opfers, geächtet zu werden – ob nun mit oder ohne strafrechtliche Folgen.“
In der Tat, dem Grafen nützt es wenig, sich sagen zu können, daß er ja eine akzeptierte Doktorarbeit geschrieben und die entsprechende mündliche Prüfung bestanden habe. Auch seinen Doktorvater wollte er nicht blamieren, eine Arbeit anerkannt zu haben, die von anderen Professoren bereits abgelehnt worden war; Kerssenbrock hatte seinem Professor rechtzeitig gestanden, daß man ihm anderen Ortes den Status des promovierten Akademikers verweigere.
Das hat er nun davon, auf der Wahrheit in der Kieler Affäre beharrt zu haben; die Wahrheit kostet zwar bei uns nicht mehr den Kopf, wohl aber noch den Status; sei es den Status offiziell verliehener Weihen, sei es den inoffizieller Zugehörigkeit zu den Zirkeln der Macht.
Wer den Status eines – wodurch auch immer – Anerkannten und Ausgezeichneten behaupten will, darf sich der Wahrheit nur bedienen, wenn das opportun ist. Und wann es opportun ist, die Wahrheit zu sagen, bestimmen in Statusfragen immer und grundsätzlich die Anderen; jene nämlich, die ihrerseits Angst haben, ihren Status zu verlieren, sobald sie gezwungen würden, für ihre Urteile und Entscheidungen immer erneut wahrheitsgemäße Rechtfertigung zu erbringen; denn der Status soll ja gerade den Wahrheitsbeweis erübrigen, entweder, weil es viel zu zeitraubend und sachaufwendig wäre, den Nachweis der Statusberechtigung immer erneut zu erbringen, oder aber, weil die Wahrheit schlechterdings nicht zu beweisen ist.
So kann jemand durchaus, gestützt auf ein Zeugnis, beweisen, daß er das Abitur abgelegt habe; wenn er aber erneut beweisen sollte, daß er nicht nur über das Stück Papier, sondern auch über die Kenntnisse verfügt, mit denen man ein Abitur bestehen kann, wäre er wohl aufgeschmissen.
Die Zuweisung des Status', ein Abiturient, ein Studierter, ein Doktor, ein Professor, ein Ministerialdirigent, ein General zu sein, erübrigt den permanenten Nachweis und Beweis von Fähigkeiten.
Gerade durch diese Bedeutung des Status' wird es aber sehr leicht möglich, einen Status unberechtigter Weise zu behaupten. Köpenickiaden sind nicht nur in den Reihen uniformierter preußischer Militärköppe für dieses Problem sprichwörtlich; sie liegen überall nahe, wo Menschen ihr Urteil über andere Menschen wesentlich vom Status bestimmen lassen, den jemand repräsentiert.
Andererseits kann, wie gesagt, auf Statusvorgaben nicht verzichtet werden, weil Zusammenarbeit und Kommunikation durch endlose und friedlose Erörterungen um die Berechtigung behaupteter Ansprüche paralysiert würden. Statusvorgaben sind also für die Kommunikation unabdingbare Vorgaben von nicht erst jeweils zu begründendem Vertrauen.
Und nun wird's spannend: Steht dem Grafen Kerssenbrock nicht der Status eines promovierten Juristen zu, wenn er doch tatsächlich promoviert wurde, also den Nachweis erbrachte, über Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt zu haben, die von seinen Doktorvätern für eine Promotion gefordert wurden? Daß deren Anforderungen Professoren anderer Hochschulen nicht genügten, kann ja wohl nicht dem Doktoranden angelastet werden. Selbst wenn er den Status eines Dr. jur. behalten hätte, wäre er dessen nicht mehr froh geworden. Die öffentlichen Hinweise auf die geringen Leistungsanforderungen bei Dissertation und Rigorosum hatten seinen Status entwertet.
Etwas anders liegen die Fälle der falschen Doktoren, über deren Statusanmaßung mit herzlicher, das heißt naiver Infamie in der Presse berichtet wird, zum Beispiel von „falschen“ Ärzten, die zum Teil Jahrzehnte lang zur vollen Zufriedenheit von Patienten und Kollegen in Krankenhäusern diagnostizierten, therapierten, operierten. Nur naive Infamie kann daraus einen peinlichen Skandal werden lassen; denn die echten Ärzte unterscheiden sich ja in diesem Falle von den falschen nicht durch gegebene und fehlende Kenntnisse und Fähigkeiten, sondern ausschließlich dadurch, daß die einen ihre Fähigkeiten formell beglaubigt bekamen, die anderen informell.
Natürlich kann man mit guten Gründen behaupten, daß die falschen Ärzte sich insofern schuldig machten, als sie bei der Einstellung wahrheitswidrig den Status eines examinierten und promovierten Arztes in Anspruch nahmen. Insofern aber bestandene Examen nur Kenntnisse und Fähigkeiten bestätigen, die auch die falschen Ärzte in ihrer Berufspraxis nachweisen konnten, bleibt an den vermeintlichen Skandalen dieser Art falscher Doktoren nur die Frage interessant, welche Bedeutung der rein formellen Beglaubigung eines Status' zugestanden werden muß. Da die Argumentation im Hinblick auf die Einstellung von Ärzten doch recht kompliziert sein kann, hier zur Erörterung dieser Frage ein anderes Beispiel: Im Dezember 1987 wurde in Nordrhein-Westfalen ein bisher außerordentlich erfolgreicher und anerkannter Orchesterleiter gezwungen, seine Position aufzugeben, nachdem sich herausgestellt hatte, daß er unberechtigterweise den Status eines Dr. phiI. in Anspruch genommen hatte. Welche Bedeutung hatte für seine Anstellung die Behauptung, promoviert zu sein? Haben die Entscheider über die Einstellung eines Dirigenten sich einen Teil der ihnen abverlangten Beurteilungen der Kandidaten erspart, indem sie den für eine Dirigentenposition völlig unerheblichen Status des Dr. phil. als Auszeichnung des Kandidaten vor anderen bewerteten?
Wenn an diesem angeblichen Skandal einer Statusanmaßung in sachlicher Hinsicht irgendetwas dran gewesen wäre, dann hätten die Entscheider über die Einstellung eines Dirigenten wegen erwiesener Inkompetenz zurücktreten müssen, da sie ihre Wahl von Statusfragen und nicht von sachdienlichen Urteilen über die Befähigung des Musikers zum Dirigenten abhängig gemacht hätten. Aber sie wählten ja, wie die Praxis unzweideutig erwies, einen fähigen Dirigenten. So what? Alles nur Fälle falscher, weil rein symbolischer Statusrepräsentation?
Man hat ja nicht nur einen Status, sondern, je nach sozialem Kontext, mehrere zugleich zu repräsentieren. Wer sich zum Beispiel herkömmlicher Statusinsignien wie eines Porsche oder des teuersten Kaschmir-Outfits bedient, vermag vielleicht den Status eines smarten Geschäftsmannes zu repräsentieren; mit seiner Art zu argumentieren oder sich zu bewegen und zu verhalten, könnte er zugleich – ganz gegen seinen Willen – den Status eines kulturell wenig inspirierten Flachkopfes signalisieren.
Da sich soziale Kontexte häufig überschneiden, kollidieren für viele Statusbewußte ihre unterschiedlichen Statusbehauptungen mit dem Resultat, sich bis zur Lächerlichkeit zu entblößen, selbst wenn der einzelne behauptete Status durchaus akzeptabel wäre.
So mag der Status eines Akademikers, eines Sparkassendirektors und eines Meisters lateinamerikanischer Tänze dem Präsidenten eines Fußballklubs vor den Mitgliedern dieses Klubs Vorabvertrauen und Autorität einbringen; in der Gemeinschaft der Akademiker oder der von Bankbossen dürfte ihm die gleichzeitige Repräsentation dieser verschiedenen Statusansprüche eher Schwierigkeiten bescheren.
Wer heute zum Beispiel vor Mitarbeitern seinen Status als Chef und den seiner gesellschaftlichen Reputation allzu sehr ins Spiel bringt, handelt sich Nachteile ein, die zur völligen Lähmung der Arbeitsabläufe führen können, obwohl sich an den rechtlichen, organisatorischen und materiellen Bedingungen der Arbeitsverhältnisse nichts ändert. Vor den unliebsamen Folgen solcher Statusbehauptungen hilft auch keine Reklamation der tatsachlichen Berechtigung, den Status eines Chefs in Anspruch nehmen zu dürfen Zwar gilt ein Status, gerade wenn er zu Recht erworben wird, für den Statusträger stets und allgemein, denn er versteht den Status ja als an seine Person gebunden. Zur Geltung bringen kann er den Status aber nur, wo er in je unterschiedlichen sozialen Situationen von seinen Partnern anerkannt wird. Zu dieser Anerkennung des behaupteten Status kann man niemanden zwingen.
Umso mehr scheinen sich alle zu bemühen herauszufinden und ins Kalkül zu stellen, welche Statushierarchien in den einzelnen sozialen Kontexten und bei den sie tragenden Gruppen gelten. Wo wirtschaftlicher Erfolg am höchsten geschätzt wird, kann der Hinweis auf den Status, adlig zu sein oder ein Dutzend Besprechungen seiner Arbeit als Künstler im Lokalfeuilleton vorweisen zu können, die erwünschte Anerkennung kaum befördern. Je gewichtiger und folgenreicher die Akzeptanz durch andere für jemanden ist, desto entschiedener muß er seine Statusansprüche reduzieren auf genau den, den die Gruppe als den entscheidenden betrachtet. Das ist leichter gesagt als getan; denn die Gruppen schützen sich und ihren inneren Zusammenhalt vor der Infiltration durch Statusprätendenten, indem sie auf mehr oder weniger subtile Weise jene Kriterien verschleiern, nach denen sie einen Statusanspruch anerkennen. Diese Kriterien liegen nicht ein für allemal fest; denn sie sind trotz aller Bemühungen um Verschleierung zu erschließen, zumal es professionelle Aufspürer der jeweils neuesten „Statussymbole“ gibt: die Gesellschaftsjournalisten, deren Arbeit allerdings niemandem etwas nützt. Sobald sie die fälschlich Symbole genannten Statusanzeigen bestimmter Gruppen enträtselt haben und mitteilen, was jeweils „in“ oder „out“ ist, sind die Gruppen ja gezwungen, die Statusanzeiger zu wechseln. Wer sich der enträtselten „Symbole“ glaubt bedienen zu können, kommt immer zu spät. Wenn bekannt wird, daß weiße linke Hände sommerfrisch gebräunter Sportstypen als eines der Statussymbole von Leuten gelten, die mit einem bestimmten Selbstverständnis Golf spielen, dann wird es einem Prätendenten auf Anerkennung durch diese Leute wenig nützen, die Haut seiner linken Hand zu bleichen. Wer in gewissen Saunen betont einen geröteten Fleck an der Innenseite seines linken Oberarms zur Schau trägt, weil er gelesen hat, eine scharf ausgegrenzte Männergesellschaft erkenne sich an solchen durch Zigarettenglut erzeugten Liebesmalen, riskiert höchstens, mit brennenden Zigaretten malträtiert anstatt in den Liebesbund aufgenommen zu werden.
Worin liegt dann aber die allgemeine Faszination an den In- und Out-Tabellen, an der Beschreibung der seltsamen Zeichen und Rituale der jeweils anderen, zu denen man nicht gehört? Was schürt das Hetzfieber, die Häme gegen jene, deren Anerkennung man nicht erzwingen kann? Wahrscheinlich ist es die Furcht vor „geschlossenen Gesellschaften“, von denen man vermutet, sie könnten zu Geheimgesellschaften mit unkontrollierbaren dunklen Machenschaften werden, weil sich die Mitglieder solcher Gruppierungen dem Außenstehenden nicht zu erkennen geben. (Vgl. Verfolgung von Freimaurern u. a., obwohl die humanistischen Ziele der Freimaurer allgemein anerkannt wurden.) Das bemerkenswerte Interesse an der Statusrepräsentation der jeweils anderen ließe sich also als das Interesse an der Kontrollierbarkeit der Mitmenschen verstehen; man will sie zur Selbstidentifikation zwingen, indem man sie auf die Deklaration ihres Status' festlegt. Sie sollen nichts anderes sein, als was sie zu sein scheinen. Das ist ein bemerkenswerter Befund angesichts des immer noch mitgeschleppten preußischen Tugendpostulats, man habe mehr zu sein als zu scheinen.
Das Interesse an Statusfragen ist nur so weit an die Frage geknüpft, was und wer jemand in Wahrheit ist, als man ihn durch seine Identifizierung sozial kontrollieren kann; das heißt, er soll kalkulierbar werden, vorausberechenbar in seinen Haltungen, Einstellungen und Interessen. Das gelingt umso eher, je ernster Statusfragen genommen werden. In dieser Hinsicht ist die demonstrative Repräsentation eines Status' geradezu als soziale Pflicht anzusehen. Wo Einzelne und Gruppen jederzeit und an jedem Ort ihren Status deklarieren, erfüllen sie diese Pflicht und haben zu Recht das Gefühl, sozial tugendhaft zu sein. Sie fördern die Kommunikation durch die Eindeutigkeit ihres Selbstverständnisses und ihre Bereitschaft, auch bei anderen zunächst einmal fraglos als gegeben zu akzeptieren, was diese anderen durch Statussignalements von sich behaupten.
Wem kann man heute noch derartige Tugend attestieren? Unseren Oberschichten? Es wird immer wieder darauf hingewiesen, daß wir im Vergleich zu Italien, Frankreich und England gar keine Oberschicht hätten. Das kann den sozialen Tatsachen nach nicht wahr sein, da die Vorstellung von der sozialen Schichtung prinzipiell auf jede Gesellschaft angewandt werden kann. Der augenfälligen Erscheinung nach haben wir deswegen keine Oberschicht, weil unsere Oberschicht im Unterschied zu der Italiens, Frankreichs und Englands ihrer Pflicht zur Statusrepräsentation nicht nachkommt. Warum? Weil sie sich durch Aufsteiger regeneriert, die nie gelernt haben, ihren veränderten Status mit jeweils neuen, ihnen bisher fremden Repräsentationen zu deklarieren? Weil sie Angst haben, sich Lösegelderpressern und Einbrechern umso eher auszuliefern, je eindeutiger sie ihren Status zu erkennen geben? Das eben ist die andere Seite der Statusrepräsentation: Status verpflichtet, auch das Risiko einzugehen, von kriminellen Elementen ausgebeutet zu werden. Man kann diesem Risiko nicht durch Anonymisierung von Vermögen, Person und Funktion entgehen wollen, ohne andererseits die positive Funktion des Statusbekenntnisses aufzugeben.
Wo unsere Oberschichten sich nicht zu erkennen geben, entziehen sie sich auch der Pflicht, zur Stabilisierung der sozialen Kommunikation beizutragen. Wenn die Adressaten noch so fragwürdiger Behauptungen über die „Herrschenden“ nicht mehr auszumachen sind oder erst mit ebenso fragwürdigen Mitteln und Methoden aus den Tarnungen ihrer Statuszuweisungen hervorgezerrt werden müssen, entstehen jene spekulativen Rundumverdächtigungen und jene Hetzhäme, die den Großteil des Gesellschaftsjournalismus ausmachen.
Es scheint unseren Statusinhabern und Statusprätendenten nicht mehr oder noch nicht wieder bewußt zu sein, was man sich mit Statuserhöhung einhandelt. Nur der Statusverlust steht ihnen als Risiko vor Augen. Mitgefangen, mitgehangen. Wer seine soziale Geltung über Statusansprüche zu behaupten versucht (und das muß mit Blick auf effektive soziale Kommunikation in gewissem Umfang jedermann tun), der kann sich im Notfall schwer darauf berufen, nur als Persönlichkeit und nackter Adam geschätzt werden zu wollen.
Zugegeben, die symbolischen und die unmittelbaren Formen der Statusrepräsentation scheinen heute instabiler zu sein als je zuvor. Sie lassen sich auch nicht mehr durch das klassische Mittel stabilisieren, die Verfügung über diese Repräsentate zu verknappen, zum Beispiel durch Verteuerung. Selbst da, wo das gelingt, wie bei den Versteigerungspreisen für Gemälde von van Gogh, Picasso, Beckmann etc., verliert der Erwerb dieser Statusinsignien allen Wert, soweit die Käufer anonym bleiben; im Gegenteil, der anonyme Kauf heizt nur die haltlosen Spekulationen über die Geheimgesellschaft an, deren Mitglieder offensichtlich unlautere Ziele verfolgen; warum sonst weigerten sie sich, als Ersteigerer der Kostbarkeiten identifiziert zu werden?
Soweit man sieht, bleibt nur ein Weg, Statuszuweisungen in ihrer positiven Wirkung auf die soziale Kommunikation zu sichern: indem man von der unmittelbaren materialen Repräsentation des Status' zu seiner symbolischen übergeht. Das Gemalde von van Gogh als materiales Objekt, die Cartier-Uhr, das Kaschmir-Outfit sind unmittelbar Statusrepräsentationen. Als Besitzer eines van Gogh sich auch als Kenner zu erweisen, verwandelt das tote Stück Leinwand in einen Bedeutungsträger, zu einem Symbol. Daraus läßt sich bereits ersehen: nicht jedes beliebige Objekt und sei es noch so teuer, ist zur Statusrepräsentation geeignet.
Kein Wunder, daß gerade Kunstwerke (in erster Linie die der bildenden Künste) und andere Kulturzeugnisse als Statusinsignien derart geschätzt werden: sie lassen sich offensichtlich am leichtesten in symbolische Repräsentate verwandeln Das ist ein bedauerlicher Irrtum, wie sich im Einzelfall immer wieder zeigt. Solange man nur dem Bürger schadenfroh glaubte, beweisen zu müssen, wie sehr er sich mit seiner Prätention, ein Edelmann zu werden, der Lächerlichkeit preisgibt, schien ja wenigstens der Edelmann ein Edelmann zu sein, weshalb man auch zu wissen schien, wie denn gelungene symbolische Repräsentation von ihrer bloß lächerlichen Anmaßung unterschieden werden könne. Das eben wissen wir nicht mehr so genau, da wir niemanden zwingen können, seine soziale Funktion eines Beispielgebers durch angemessenen symbolischen Statusausweis zu erfüllen.
Der Gesellschaftsjournalismus führt en suite das Stück „Der Edelmann als Bürger“, der Statusprätendent als lächerliche Figur auf. Entsprechend lächerlich repräsentiert sich unsere Gesellschaft bei Staatsakten und Firmenjubiläen, bei internationalen Konferenzen und in Feriencamps, selbst wenn die vorgezeigten materialen Repräsentate zum besten gehören, was geboten werden kann. Einen Frack zu tragen, gar mit einem Orden am Bande, heißt eben mehr, als sich einer Situation anzupassen; es hieße, sie zu definieren und sie zu gestalten. Verweigerte Anpassung (zum Beispiel durch bewußte Beliebigkeit der Kleidung) ergibt noch keine tragfähigere Definition der sozialen Gelegenheit und sinnvoller Kommunikation. Solche (heute allseits als Ausweis aufgeklärten Verzichts auf symbolische Repräsentation) akzeptierte Beliebigkeit ist kaum mehr als der Versuch, sich der Verpflichtung zur Identifikation zu entziehen.
Aber Vermummungsverbote helfen gegenüber ohnehin Nackten wenig. Der gläserne Mensch kann den Anforderungen zu sozialer Kommunikation nicht genügen; man sollte die zur symbolischen Repräsentation Unfähigen in jedem Falle daran hindern, ihr Versagen als zeitgemäße demokratische Tugend ausgeben zu dürfen. Dagegen Widerstand zu leisten, hieße zunächst einmal, die Formen der symbolischen Repräsentation von Statusansprüchen und Statuszuweisungen zu verfeinern und demonstrativ zu nutzen. Ein hartes Stück Arbeit, aber lohnend, vor allem für den Gesellschaftsjournalismus, der sich nicht länger damit zufrieden geben sollte, immer nur das zu enthüllen, was durch die Enthüllung schon nicht mehr gilt.