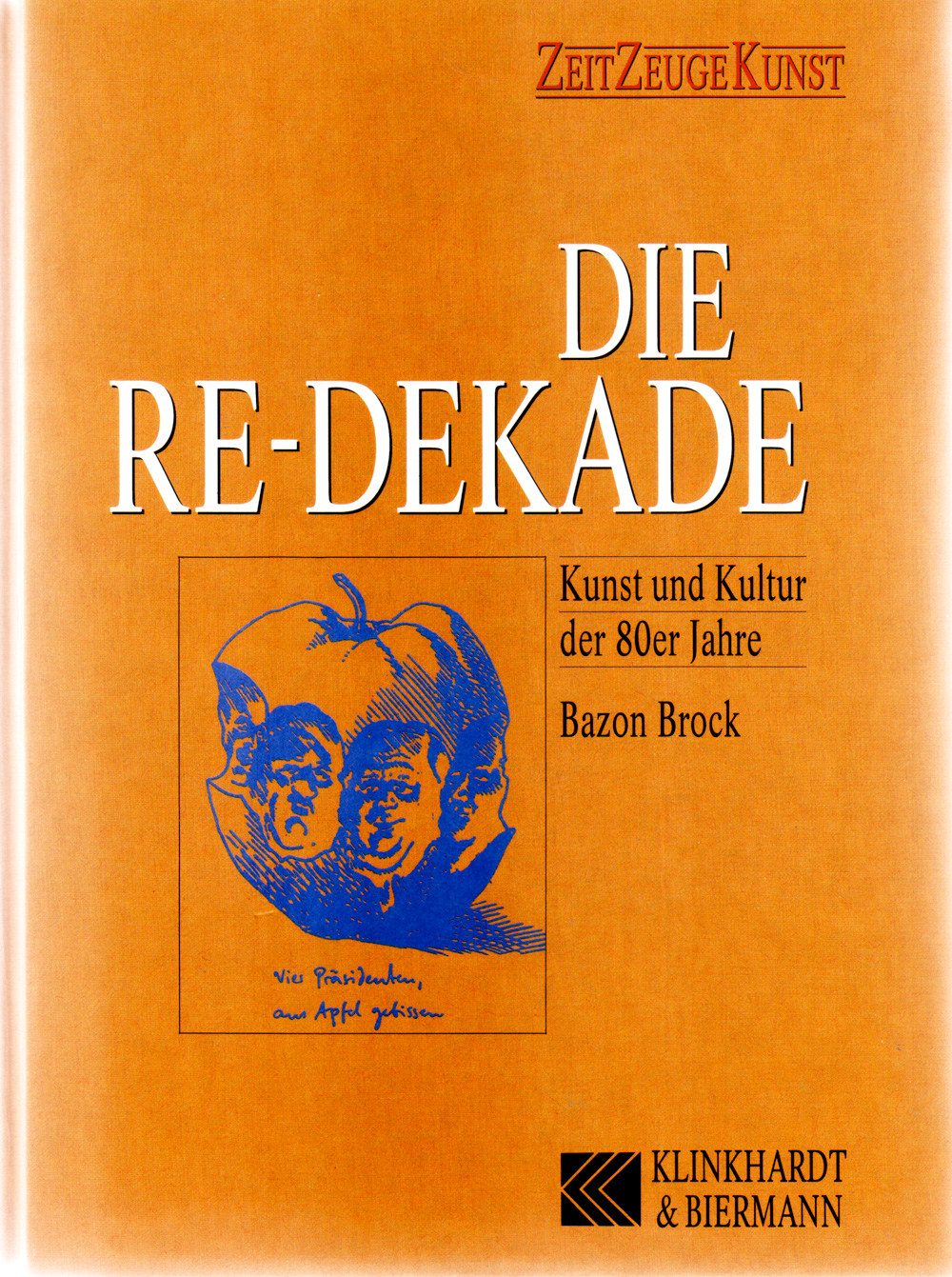In der Moderne wurde das Spektrum der klassischen Tätertypen um drei herausragende Rollen erweitert: die der Lehrer, der Therapeuten und der Trainer. In den 80er Jahren kam besonders der private Kunsttherapeut zur Geltung; die Lehrer und Trainer, sei es als Sport-, Unternehmens- oder Überlebenstrainer respektive als Fahrschullehrer oder Tierpädagogen, hatten ihren großen Nutzen schon vorher bewiesen. Das Publikum wurde nun mit Einladungen privater Kreativ-Zentren, Bastelstuben und Kunstwerkstätten geradezu überschüttet. Selbst honorige Reiseunternehmen glaubten, auf den Hinweis nicht verzichten zu dürfen, in ihren Feriencamps werde der Reisende zu allerlei kreativer Tätigkeit angeregt. Die Kunsttherapeuten nannte man dort Kulturanimateure. Den Zeitgenossen gingen Programme unter dem Sammelnamen „Kunst als Therapie“ mehr oder weniger problemlos ein. Das Besondere an den selbsternannten Kunsttherapeuten war, daß sie sich nicht mehr psychoanalytischer Ansätze, aber auch nicht verhaltenstherapeutischer oder sozialpsychologischer, bedienten; zumeist waren die Therapeuten auch gar keine – sie waren Künstler, die auf die merkwürdige Idee verfielen, Malen, Zeichnen, Töpfern und Batiken sei für jedermann eine irgendwie sinnvolle Tätigkeit und habe therapeutische Effekte. Wer etwas gestaltend realisiere, wem also etwas gelinge, der bestärke sich selbst positiv – und im Erzielen dieses Effektes sei die Therapie gelungen.
Wie kam es zur allgemeinen Akzeptanz dieser kuriosen Programme, die vorgeben, zum Beispiel durch Arbeitslosigkeit sozial krank Gewordene vor dem Abgleiten in die Asozialität bewahren zu können oder Gefängnisinsassen durch Bildhauern resozialisieren zu können? Warum hielt man ausgerechnet das sogenannte künstlerische Schaffen für geeignet, solche höchst ehrenwerten Ziele zu erreichen?
In einer Hinsicht ist die Antwort klar: vom Aufwand her sind Malen, Zeichnen und Plastizieren so gut wie an jedem Ort jederzeit zu ermöglichen. Auch können sich zugleich auf relativ beschränktem Raum viele Teilnehmer unter Anleitung eines Kunsttherapeuten den Übungen hingeben. Außerdem glaubt man, davon ausgehen zu können, daß zu dieser Art von Betätigung jeder Mensch von Natur aus hinreichende Voraussetzungen mitbringt, soweit er nur gesunde Augen und Hände habe.
Bedenklicher ist eine andere Ableitung der Auffassung, künstlerisches Schaffen befreie aus Ängsten und Depressionen, mache fröhlich und frei. Offensichtlich wurden etablierte und wissenschaftlich ausgebildete Psychiater und Therapeuten dahingehend mißverstanden, sie hätten die therapeutische Wirkung des Malens und Zeichnens, des Theaterspielens und Musizierens nachgewiesen. Genau das haben aber die Berner oder Wiener Psychiater niemals behauptet. Wenn sie ihre Patienten zu entsprechenden Werken stimulierten, nutzten sie diese gestalterischen Äußerungen, um die Vorstellungswelt ihrer Patienten besser kennenzulernen und um zu beweisen, daß beispielsweise Schizophrene durchaus in der Lage sind, in sich völlig geschlossene, logisch kohärente Aussagen zustande zu bringen. Den Psychiatern kam es darauf an, diese völlig eigenständigen, aber hermetisch verschlüsselten Logiken zu rekonstruieren, um so mit den Kranken in ihrer eigenen Welt kommunizieren zu können. Das sollte man eigentlich als Verfahren der Therapierung der gesunden Ärzte verstehen, deren Normalität, wie die jedes „Gesunden“, nur um den Preis gesichert werden kann, die Welt der „Geisteskranken“ als Wahnwelt auszugrenzen.
Was ist daraus in den 80er-Jahre-Programmen von Kunst als Therapie geworden? Was wurde aus dem um die Jahrhundertwende entwickelten Paradigma „Genie und Wahnsinn“, das nicht von den Patienten der Psychiater ausging, sondern von Künstlerbiographien des 19. Jahrhunderts? Die klassischen Studien – der Hinweis auf Lange-Eichbaum oder Thomas Mann mag genügen – hat bisher niemand unter dem Tenor „Kunst als Therapie“ zu subsumieren gewagt. Denn diese Künstlerbiographien bewiesen eindeutig, daß Künstler ihre Arbeit durchweg als schlimmste Plackerei verstanden, die Körper und Geist durch permanente Überanstrengung ruinierte. Um sich das Letzte abzuverlangen, konsumierten die meisten Kaffee, Alkohol und andere Rauschmittel, deren Wirkung sie periodisch zu sozialen Exzessen trieb. Auch wenn man die häufigen Bekundungen, diesen unerträglichen Zustand durch Selbstmord zu beenden, nicht allzu ernst nimmt, so ist doch glaubwürdig, daß diese Künstler nur allzu gern ihre zu Obsessionen gesteigerten Lebens- und Arbeitsformen aufgegeben hätten, wenn ihnen das möglich gewesen wäre. Da das offensichtlich nicht gelang, rationalisierten sie den eigenen Zustand: psychisches, physisches und soziales Kranksein wurde zur Voraussetzung des künstlerischen Schaffens erhoben. Rationalisierungen versuchen, etwas ohnehin nicht Veränderbares mit nachträglich gesuchten Begründungen als etwas von vornherein gar nicht anders Gewolltes darzustellen.
Was aber hatten die Balanceakrobaten zwischen Genie und Wahnsinn tatsächlich gewollt? Das ist aus ihren Selbstbekenntnissen und auch aus ihren Arbeiten durchaus zu erschließen, wenn man sich einmal darauf einläßt, sie mit heutigem Verständnis von „Therapie durch Kunst“ und „Kunst als Therapie“ zu betrachten. Auch die Poètes maudits (Prototyp Baudelaire), die Künstler der Décadence (Prototyp Friedrich Nietzsche), die Künstler des Ästhetizismus (Prototyp Oscar Wilde), die Künstler des „Fanatismus zur Transzendenz“ (Prototyp Gottfried Benn) haben, so könnte man meinen, ihr Schaffen als den Versuch aufgefaßt, sich vor dem Verfall, vor dem Abgleiten in Wahnsinn und Selbstzerstörung zu bewahren. Wenn man beispielsweise Baudelaires Eintragungen in sein „Intimes Tagebuch“ und in die Programmschrift „Mein Herz ohne alle Hüllen“ liest, wird man von der Eindeutigkeit überrascht, mit der sich Baudelaire gegen die Exzesse künstlerischen Schöpfertums auf ein normales Arbeitsleben zu verpflichten versuchte. Unzweifelhaft wollte Baudelaire dem Imperativ „man muß absolut modern sein“ mit entsprechenden Formen des Lebens und Arbeitens folgen. Modern zu sein hieß, nicht nur für die Agenten der Industriegesellschaft, sondern eben auch für ihn als Künstler, nichts als zu arbeiten, anstatt Offenbarungen aus sich zu entlassen. Baudelaire setzte sein Konstrukt der Modernität als ingenieurhaftes Arbeiten nach festen Regeln und Arbeitsplänen den herkömmlichen Auffassungen über die Tätigkeit der Dichtergenies und Künstlerpropheten entgegen. Je weiter ihn sein Zustand von diesem Leitbild der Modernität entfernte, desto stärker malte er das Gegenbild aus. Wenn man das als eine Möglichkeit der Selbsttherapierung bewerten möchte, so liefe sie darauf hinaus, aus dem Dasein des Künstlers umzusteigen in die Rolle eines Ingenieurs und Konstrukteurs. Als Therapie hätte dann die Immunisierung gegen die Kunst zu gelten respektive der Widerstand gegen die Verführung zu tradiertem Künstlerselbstverständnis.
Dieses Ziel der Therapie können heutige Kunsttherapeuten für ihre Laienklientel selbstverständlich nicht reklamieren – wohl aber für sich. Ist es unstatthaft, den Kunsttherapeuten zu unterstellen, sie kompensierten in den Kreativitäts- und Selbstverwirklichungsanleitungen für jedermann ihren Mißerfolg als Künstler? Tatsache ist, daß durchweg nur diejenigen Kunsttherapie betreiben, die sich als Künstler nicht durchzusetzen vermochten. Das Ziel der Therapie ist wohl auch für sie, wie schon für Baudelaire, aus der Rolle des Künstlers in die des Lehrers, Trainers und Therapeuten überzuwechseln, ohne das Malen und Zeichnen, das Theaterspielen und Schreiben aufgeben zu müssen. Auch Nietzsches „Blonde Bestie“ war das Resultat solcher Therapie; sie hatte das Kunstschaffen weit hinter sich zu bringen, um als Tatmensch die Sphäre des ästhetischen Scheins, also die Welt der Formen und Ideen nahtlos ins praktische Leben zu überführen.
Der therapierte Künstler bedarf der Kunst nicht mehr, weil er praktisch handelt und statt Papier und Leinwand die Welt gestaltet.
Oscar Wilde hat nicht erst mit der freiwillig oder mutwillig auf sich genommenen Gefängnisstrafe gezeigt, wie sehr es ihm als Ästhetizisten darauf ankam, die Normalität des gesellschaftlichen Lebens zu erreichen. Zweifellos litt er unter gesellschaftlicher Stigmatisierung als Anormaler, gar Asozialer, hatte er doch als Dandy gerade den Versuch gemacht, künstlerische Wahrnehmungs- und Urteilsformen zu allgemeinen zu erheben, also gesellschaftlich wirksam werden zu lassen. In diesem Sinne hatte er angestrebt, die Gesellschaft zu therapieren, allerdings dabei übersehen, daß deren Normalität auf die Ausgrenzung des künstlerischen Verhaltens als anormal angewiesen war. Inoffiziell praktizierten die guten Bürger das, was sie offiziell ablehnten. Naiverweise glaubten die Ästhetizisten, die Viktorianer überzeugen zu können, die im Geheimen ausgelebten Wünsche öffentlich zu praktizieren, so wie es die Dandys selber taten. Dazu empfahlen sie eine neue Unterscheidung zwischen Normalität und Anormalität. Wo faktisch die Normalen und Gesunden das praktizierten, was sie für anormal und krank hielten, konnte die Unterscheidung zwischen Normalbürger und Künstler nur darin bestehen, daß die einen es wagten, sich selbst zu thematisieren und die andern eben nicht. Der Gesunde war nur jener Kranke, der es nicht wagte, seinen Zustand zur Kenntnis zu nehmen. Das mußten die Bürger als Schwächung ihrer Lebensbasis auffassen. Zwar anerkannten sie durchaus, daß Krankheit die Thematisierung der Existenz erzwingt, womöglich auch Wahrnehmung und Urteilsfähigkeit verfeinert. Aber solche Sensibilisierung konnte nur dazu führen, daß man die Unbedenklichkeit, den Egoismus und die Rücksichtslosigkeit nicht mehr aufbrachte, die der bürgerliche Existenzkampf forderte. Sich selbst als den Kranken zu erkennen, der man tatsächlich war, schien ihnen als Therapie eine Perversion zu sein, die man lustvoll nur zu genießen bereit war, solange sie im Geheimen blieb – ein merkwürdiges Geheimnis, weil an ihm so gut wie alle Bürger teilhatten, von der Aristokratie ganz zu schweigen. Sie akzeptierten die Kunst als allgemein zugängliche Einführung in dieses Geheimnis, das keines war, aber als eines beschworen werden mußte. Dagegen kam die therapeutische Empfehlung der Dandys, das von allen geteilte Geheimnis als Normalität anzuerkennen, kaum zur Geltung. Daran hat sich bis heute trotz weltweiter Etablierung von Psychoanalytikern und Therapeuten wenig geändert. Schon gar nicht durch die Kunsttherapeuten.
In der Entwicklung des künstlerischen Selbstverständnisses von Gottfried Benn hat es wohl Augenblicke gegeben, in denen er glaubte, seinen „Fanatismus zur Transzendenz“ in soziale Therapie überführen zu können. Was für ihn bis 1933 ausschließlich Antrieb zur Entfaltung künstlerischer Radikalität gewesen war, schien ihm in den drei darauffolgenden Jahren auch als Motor sozialevolutionärer Höherentwicklung leistungsfähig zu sein. Die Olympiade der negativen Erscheinungen, des Verfalls und des Autismus, die er in seiner Lyrik besungen hatte, wollte er mit der deutschen Revolution der Nazis harmonisieren, da mit den von ihm identifizierten negativen Erscheinungen immer schon ein entsprechendes Entwicklungsziel mitgemeint war. Die züchterische Höherentwicklung, also die Befreiungen aus der Qual des künstlerischen Autismus ließ sich als Absetzung von negativen Erscheinungen definieren. Niemand weiß, was aus Gottfried Benns zeitweiliger Bereitschaft geworden wäre, die nicht zuletzt von ihm selbst repräsentierte Verfallskunst einer Therapie durch die Politik zu unterwerfen, wenn ihm die Nazis ab 1936 nicht unmißverständlich ihre Ablehnung seiner „verfallsbürgerlichen“ Person, nicht seines Programms, klargemacht hätten. Benns Schmähschriften (2) gegen die exilierten Kollegen von einst und seine Huldigungsadressen an die nationalsozialistischen Kultur- und Gesellschaftsprogrammatiker lassen das Schlimmste für den Fall erwarten, daß Benn (etwa so wie Carl Schmitt) akzeptiert worden wäre. Er hatte das unverdiente Glück, von seinen Politpartnern überschätzt zu werden. Dabei gab es doch zwischen ihnen und ihm nur einen Unterschied im Stilniveau, auf dem man das gemeinsame Programm vertrat. Es war das Programm aller Klassizisten, die sich gegen das Paradigma von „Genie und Wahnsinn“ auf das der heroischen Gesundheit und den Vollbesitz aller geistigen und körperlichen Kräfte als Voraussetzung künstlerischen Schaffens ausgerichtet hatten.
Von Goethes Ablehnung der romantischen Willkür bis zu Goebbels‘ Kampagne gegen die entartete Kunst spannt sich der Bogen. Hitler, Speer und Breker gingen sogar hinter den Klassizismus zurück in die griechisch-römische Klassik der Antike. Sie betrachteten sich als Reinkarnation von Phidias, Iktinos und Perikles, die Baumeister und Programmatiker der Athener Akropolis. Hitler, Speer und Breker bekräftigen mit ihrer morgendlichen Erscheinung auf der Plattform des Trocadéro in Paris das antike Bündnis von Staatsmann, Architekt und Bildendem Künstler, für das die drei Erbauer der Akropolis seit altersher standen. Hitler und Kompagnons beschworen den „Fanatismus zur Transzendenz“ als Erzwingung tausendjähriger Gültigkeit und Dauer des Schönen und Wahren genauso wie Gottfried Benn. Hitler dekretierte: Kunst ist eine zum Fanatismus verpflichtende und über alle zeitliche Bindung erhabene Mission.
Wenn die klassizistische Moderne die schöpferische Eruption des Künstlers (stimuliert von Rauschgiften, radikalisiert durch selbstinduzierte Krankheiten) austauschen wollte gegen methodisches Arbeiten, wie es für die Industriegesellschaft unabdingbar ist, dann wird jede Form des Arbeitens gleichermaßen zur künstlerischen.
Hitler konnte sich tatsächlich als Künstler verstehen, der mit erprobten Gestaltungsformen des Bildenden Künstlers nun den sozialen Körper, die Gesellschaft formte, und das heißt, auf angeblich wenige Formen verpflichtete. Diesem Arbeitspensum gegenüber erschienen die Methoden der sich selbst therapierenden Privatkünstler als historisch überwunden, als unzeitgemäß, unmodern und krankhaft. Diese Beurteilung hatten vor allem jene Künstler nahegelegl, die sich auf Krankheit als Voraussetzung von Produktivität berufen hatten und deren Kunstschaffen als anerkennenswerter, aber fehlgeschlagener Versuch angesehen wurde, sich selbst zu therapieren. Hitler (3) bot den „kranken“ Künstlern ernsthaft eine erfolgversprechendere Therapie an, die auf genau das hinauslief, was man im Fin-de-siècle empfahl: die Anerkennung der Tatsache, daß die bürgerliche Gesellschaft krank war, ohne sich dies eingestehen zu können. Ausgerechnet ein Repräsentant der jüdischen Intelligenz entwickelte für die Erscheinungsform der Kunst in der bürgerlichen Gesellschaft die Kennzeichnung „entartet“. Damit sollte ein Absetzbewegung ermöglicht werden, die jener Intellektuelle selbst vormachte: er änderte seinen Namen Südfeld in Nordau (4). Der bis dahin nur von Jugendbünden beschworene nordisch-germanische Geist schien von der durch Krankheit bedingten und krankmachenden bürgerlichen Kunstpraxis (trotz Ibsen, Strindberg, Munch) nicht berührt worden und deshalb der Antike näher zu sein. Diese Vorstellung verstehen zu können, fällt heute deswegen schwer, weil sich in ihr die herkömmlichen Unterscheidungen von reaktionär und progressiv, von rechts und links, von konservativ und revolutionär bis zur Unkenntlichkeit verwischen. Die Therapie als Immunisierung gegen die private und vereinzelte Künstlertätigkeit durch deren Aufhebung in politischer, technischer, wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Weltgestaltung wurde gerade von Blut- und Bodenmystikern, von Unmittelbarkeitsfanatikern und Traditionsfundamentalisten, also von lauter Kranken, vertreten.
Wußten sie das von sich selbst? Das muß man wohl annehmen, wie man auch annehmen muß, daß Goebbels wußte, wie wenig er in körperlicher Gestalt, privatem Leben und politischer Geschäftigkeit dem Postulat des gesunden arischen Kulturhelden entsprach. Wie konnte man bei dieser Einsicht noch derartige Forderungen vertreten? Ungefähr so, wie die Tierzüchter mit dem ihnen zur Verfügung stehenden Erbmaterial umgingen: das Zuchtziel der Veredelung konnte erst in der Zukunft erreicht werden; der Blick auf den vorhandenen Tierbestand ließ das Zuchtprogramm nur umso unabweislicher erscheinen. So mochten auch die Träger der Kampagnen gegen die Entartung der Kultur aus der realistischen Einschätzung ihres eigenen Tuns die Forderungen der Gesundung abgeleitet haben. Wer diese Forderung gegen die eigene Entartung akzeptierte, sollte von dem Stigma, selber entartet zu sein, verschont bleiben. Geradezu flehentlich bat Hitler die Verfallskünstler, ihren eigenen Zustand als krankhaft einzugestehen, denn dann brauchte man nicht länger gegen sie vorzugehen.
Die Nazis empfanden dieses Vorgehen durchaus als barbarisch (5), jedenfalls wehrten sie sich dagegen, von aller Welt für barbarisch gehalten zu werden. Das ist ihnen nicht gelungen, aber das Programm lebte nicht nur in der Bundesrepublik der 80er Jahre wieder auf, sondern wird auch heute noch von den linken und rechten, grünen und schwarzen Fundamentalisten repräsentiert. Da in den 80er Jahren solcher Fundamentalismus verstärkt in Erscheinung trat, konnte sich das entsprechende Instrumentarium als Kunsttherapie etablieren.
Einübungen ins künstlerische Arbeiten, und seien sie noch so anspruchslos, beruhen heute wieder auf der Sehnsucht, die Kunst als ein meisterliches Können und Vermögen gegen die Kunst als krankhafte oder krankmachende Obsession durchsetzen zu können. Wie gesagt, für diese Behauptung lieferten die Künstler der Moderne selber die Begründungen. Wieso glaubten sich die Modernen auf die Ausdrucksformen der sogenannten primitiven Völker, der Geisteskranken, der spirituellen Kosmiker und Dilettanten zur Stimulierung ihrer eigenen Arbeiten einlassen zu können, um sich dann aber vehement gegen ihre Stigmatisierung als primitiv, geisteskrank und dilettantisch mit allen Mitteln zur Wehr zu setzen? Sie glaubten es wohl, weil das Paradigma von der Modernität als ingenieurhaftem Arbeiten biographieloser Angestellter der Industriegesellschaft ohne das klassizistische Gegenparadigma nicht formulierbar war. Nur aus dieser Wechselbeziehung zwischen klassizistischer Modernität und krankhafter, nämlich auf Abweichung von der Norm ausgerichteter Individualität, die man nur im herkömmlichen Rollenverhalten der Künstler ausleben konnte, ist zu verstehen, warum Expressionisten und Bauhäusler, Konstruktivisten und Neusachliche, Fauves und Kubisten nicht nur den Umständen entsprechend zugleich als entartet und aufklärend, als formalistisch und sozialrevolutionär, als historisch obsolet und zukunftsweisend, geschmäht, gelobt, verflucht und beweihräuchert werden konnten – und zwar von Künstlern gegenüber Künstlern, von Kleinbürgern gegenüber Kleinbürgern, von Bonzen gegenüber Banausen, von Therapeuten gegenüber Patienten, von den Nazis gegenüber den italienischen Faschisten, von Demokraten gegenüber Diktatoren und vice versa. Die angeblich unversöhnlichen Positionen begründeten sich wechselseitig und traten so gut wie in jedem Werk und Konzept der modernen Künstler vereint in Erscheinung. Begriffe wie modern, avantgardistisch, entartet, traditionalistisch mögen immer wieder programmatisch verstanden worden sein; aber die Programmatiken hoben sich gegenseitig auf. Operieren kann man mit ihnen nur, wenn man sie als Strukturbegriffe faßt. Sie kennzeichnen Formen des Diskurses und der Argumentation als Strategien der Problematisierung und sind deshalb zur Repräsentanz weltanschaulicher oder politischer Programmatiken untauglich. Therapie durch Einübung in die Fähigkeit zu problematisieren: in dieser Hinsicht erwiesen sich die kranken Künstler als extrem durchhaltefähig, unerbittlich, ja heroisch. Die angeblich Verrückten und Entarteten begründeten durchweg neue Artungen als akademische Stile und umgekehrt entpuppten sich die Neoklassizisten im Stolz auf ihre Könnerschaft und Traditionsgebundenheit als kraftlos, solange sie nicht wenigstens einsahen, daß sie gerade wegen ihrer begrenzten Fähigkeiten die angeblich unveränderbaren Formideen propagiert hatten.
Wo es tatsächlich gelang, sich diesen Ideen durch ihre Problematisierung im „schwarzen Quadrat“ anzunähern, erwiesen sich die als „Formalisten“ geschmähten Künstler als gesellschaftlich so subversiv wie schon die Gründerväter der Moderne, die zugleich auch die extremsten Verfechter der Antimoderne waren. Man kann Baudelaire, Nietzsche, Wilde nicht nur für die eine Seite in Anspruch nehmen, um gegen die andere sich abzusetzen. Beide Seiten in jedem Künstler zugleich zu sehen, ist aber nur möglich, wenn man ihre Positionen nicht in Handlungsanleitungen zur Therapierung der Welt und der Menschen durch künstlerische Optimierung, sprich Veredelung des Vorhandenen, überführt – sie taugen nur für das Gegenteil, nämlich zur Thematisierung und Problematisierung noch der edelsten Ziele, dauerhaftesten Ideen und selbstverständlichsten Wahrheiten. Das ist das zentrale Motiv der Modernität, darin liegt ihre Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft.
Die 80er Jahre eröffneten mit dem feuilletonistischen Stoßseufzer „Nun malen und schreiben sie wieder, unsere Künstler!“ Das sollte heißen, daß sie nicht mehr bloß denken und konzipieren und ihr eigenes Metier problematisieren. Die bauchgesteuerten Vollblutmaler erhielten freudig jene begeisternde Zustimmung zu ihren Werken, die sie als deren angemessenste Rezeption einforderten.
Die Kunsttherapeuten beeilten sich denn auch, Begeisterung für das künstlerische Gelingen jedes beliebigen Ausdrucksgestus zu erwecken und die „künstlerische Selbstverwirklichung“ dem konzeptionellen Denken und der Kritik der natürlichen wie der sozialen Wahrnehmung entgegenzusetzen. Sie ließen vor ihrer Klientel wieder das Ideal eines gesunden, ganzheitlichen, friedfertigen Künstlers erstrahlen. Wie sehr man sich auf dieses Ideal verpflichten wollte, wurde in den zahllosen Talkshows sichtbar, in denen das Publikum mit Arbeiten von zeitgenössischen Profikünstlern konfrontiert wurde. Mit tränenerstickter Stimme bekannte man, daß mit der von solchen Kunstwerken immer erneut vorgeführten Selbstproblematisierung der Kunst „ein Ideal zerstört“ werde. Man könne sich nicht damit zufrieden geben, von den Künstlern immer wieder nur das Elend vorgeführt zu bekommen, in dem man tagtäglich stecke; man verlange von ihnen vielmehr das Gegenbild zu diesen Zuständen. Solche Haltungen sind nicht nur rührend, sie treffen sich in der Wechselbeziehung von Anormalität sowie für krankhaft gehaltener Abweichung einerseits und der durch diese Abweichung hervorgerufenen Sehnsucht nach der verbindlichen Ordnung überzeitlicher und überindividueller Formen andererseits. „Verfallskunst“ und Klassizismus waren und sind nicht einander ablösende, die Epochen jeweils dominierende künstlerische Haltungen, Hervorbringungsweisen oder gar Stile; sie treten immer gemeinsam auf als sich bedingende Unterscheidungen wie etwa die Unterscheidung von öffentlich und privat, von individuell und kollektiv. Die beiden Haltungen sind keine wählbaren Alternativen zueinander. Wer die Ausschließlichkeit der einen gegen die andere mit politischen oder wirtschaftlichen Sanktionen zu erzwingen versucht, zerstört beide. Das war schon die Erfahrung von Hitler und Goebbels, als sie nach der Eliminierung der „Verfallskunst“ konsterniert bemerken mußten, daß sich das klassizistische Gegenbild nicht etablieren ließ. Auf ihre Frage, wo denn nun eigentlich alle jene Künstler seien, die bisher von der verjudeten, intellektualistischen und entarteten bürgerlichen Schmiererei aus der Öffentlichkeit verdrängt worden waren, gab es nur eine Antwort: nur die als entartet geschmähten modernen Künstler selbst wären als diese gesuchten Gegenbilder in Frage gekommen, also die Kubisten, die Futuristen, die Konstruktivisten, die Bauhäusler, die De Stijl-Künstler und, wie gesagt, Gottfried Benn, Ernst Jünger, Stefan George, Thomas Mann und Oswald Spengler.
Verzweifelt fragt man sich immer wieder, warum nach hundert Jahren Diskussion die gleichen Argumente für und wider die „moderne Kunst“ vorgetragen werden können, so als hätte die Geschichte dieser Auseinandersetzung keinerlei Beweiskraft. Glaubwürdige Demokraten, wie beispielsweise Thilo Koch und Henry Nannen, polemisierten, als hätte es die entartete Kunstkampagne nicht gegeben, gegen informelle und Konzept-Künstler, gegen Happenisten und Pop-Artisten genauso wie Altstalinisten und Kunstontologen, deren Repräsentanten, z. B. Richard W. Eichler (6), immer noch damit beschäftigt sind, künstlerische Könner gegen die angeblichen Scharlatane der Moderne zu beschwören. Die spontane Frage „Und das soll Kunst sein?“ wird von den Werken der Moderne und ihren Autoren selbst gestellt und nicht nur von perfiden Ausbeutern des gesunden Menschenverstandes. Und die Künstler stellen diese Frage mit jeder neuen Arbeit viel radikaler als diejenigen, die eigentlich nur ihr Verdammungsurteil gegen die Moderne moderieren. Wenn unsere Kunsttherapeuten ihre Kundschaft zu solcher Radikalität des In-Frage-Stellens anleiten wollten und könnten, dürften sie sich selbst endlich wieder als Künstler verstehen. Und das ist ja wohl der Zweck des therapeutischen Mühens in den 80er Jahren gewesen.
• (2) Dieter Wellershoff: Gottfried Benn – Phänotyp dieser Stunde, Köln 1958, S. 155 ff u. Gottfried Benn: Prosa und Autobiographie, Gesammelte Werke in der Fassung der Erstdrucke, Ffm 1984, S. 295.
• (3) Rede Hitlers am 19.7.1937 in München, in: RKdbK, 1. 8.1937
• (4) Beitrag Bazon Brock, in: Brock/Preiß (Hg.): Kunst auf Befehl? München 1990
• (5) Josef Goebbels: Reden 1932-39, München 1971, Bd. 1, S. 138: „Kein Vorwurf hat uns in der Vergangenheit so tief zu treffen vermocht wie der, daß der Nationalsozialismus geistige Barbarei sei …“
• (6) Richard Eichler: Künstler, Könner, Scharlatane, München 19675 u. Ephraim Kishon: An die Bürgerinitiative Rathenauplatz, Der Tagesspiegel, Berlin 29.8.1987