1 Summarisch
Kaum ein Aspekt der sogenannten modernen Kunst ist so leidenschaftlich diskutiert worden wie ihr Fragmentcharakter. Die Collage-Techniken von Kurt Schwitters; die Dekontextuierungen der Ready-mades von Marcel Duchamp; die schöpferischen Destruktionen der Futuristen; die sich selbst vernichtenden Maschinensysteme von Jean Tinguely; die Decollageaktionen von Vostell; die Übermalungen von Arnulf Rainer; die Schlitz- und Bohrtechniken Lucio Fontanas; die Selbstverstümmelungen von Günter Brus; die Modell-Ruinen der Poiriers; die Ruinenarchitekturen der Site-Gruppe boten und bieten immer erneut Anlaß für die Erörterung der Frage, in welcher Weise die Künstler die gleichermaßen in diesem Jahrhundert gegebenen Tendenzen zur Fragmentarisierung einerseits und zur Systemkonstruktion andererseits zu bewältigen versuchen.
Daß auch den Künstlern die Klärung des vermutbaren Zusammenhangs von Zerstückelung, Zerstörung, Vereinzelung und den totalitären Systemkonstruktionen vordringlich zu sein scheint, darauf macht Heinz Althöfer in einer instruktiven Übersicht aufmerksam.(2) Allerdings gehen seine Überlegungen von der für Restauratoren entscheidenden Einsicht aus, daß "Alterung ein integrer Bestandteil des Kunstwerks" ist und daß deshalb die Ruinosität als ästhetische Erscheinung eine unvermeidbare Konsequenz des Kunstschaffens darstelle.
Althöfers Überlegungen sind weniger auf erkenntnistheoretische Aspekte des Fragmentarismus ausgerichtet, wie sie beispielsweise der Kunsthistoriker Schmoll, genannt Eisenwerth, mit seinem Topos des "Infinito" gekennzeichnet hat. Doch arbeitet Althöfer deutlich die Fragestellung heraus, ob sich für die Kunst dieses Jahrhunderts nicht die Problemstellung "Fragment gegen System" dahingehend interpretieren lassen muß, daß sich der Fragmentarismus selbst zum Gegensystem entwickelt hat. Damit wäre aber weitestgehend jene Offenheit der modernen Werke wieder verspielt, die - vor allem von Benjamin - als Charakteristikum der nichtnormativen Werkkonstruktionen gegenüber der normativen Werk-Totalität postuliert wurde.
Folgende grobe Typisierung des Fragment-Systemzusammenhanges läßt sich für die Kunstpraxis angeben:
a) Die Fragmente werden als Reste eines Systems aufgefaßt, wobei die Zerlegung des Systems in fragmenthafte Splitter sowohl durch historisches Altern wie durch geplante oder zufällige Gewalteinwirkung entstanden sein kann. Eine Sonderform stellt die Fragmentarisierung eines Systems durch dessen experimentelle Zerlegung dar, ohne daß das Experiment zum Aufspüren des bedingenden Konstruktionsprinzips des Systems geführt hätte, weshalb die fragmentierten Elemente nicht wieder zu einem neuen Ganzen zusammengefügt werden konnten.
b) Heterogene Elemente der Gestaltung können nur noch unter formalen Bedingungen -wie räumliche und zeitliche Rahmung - in Beziehung gesetzt werden, ohne daß damit auch ein Systemzusammenhang erreichbar wäre.
c) Einzelne Elemente verschiedener Gestaltungszusammenhänge werden collagiert, so daß ihnen der Verweis auf ihren Ursprung nicht mehr ablesbar ist.
d) Der Zusammenschluß von Elementen zu einer systematischen Ordnung wird für prinzipiell uneinlösbar gehalten. Die Fragmente bleiben auch gegeneinander isoliert. Allgemein wird bezweifelt, daß stilistischer Gestaltungsdurchgriff die Elemente der Gestaltung noch zu einer Einheit mit System-Anspruch zusammenschließen kann. Ebenso zweifelhaft erscheint die Möglichkeit, den Anspruch auf ein Ganzes als dem Vollendeten durch Erfüllung eines normativen Gestaltungskanons zu erreichen. Desgleichen kann die Einheit der künstlerischen Persönlichkeit nicht mehr für so bestimmt und unveränderlich gehalten werden, daß ihr fragmentarisches Tun allein schon durch die Tatsache als einheitlich erfahren werden könnte, daß der gleiche Künstler die fragmenthaften Gestaltungen hervorgebracht hat.
So bleibt allein die von Panofsky so genannte intrinsische Bedeutung als Kraft der Vereinheitlichung von Fragmenten zu Symptomketten. Die intrinsische Bedeutung einzelner künstlerischer Handlungen ergibt sich aus den erst post festum erarbeitbaren Handlungsmöglichkeiten aller Individuen einer Zeit. So werden auch die heterogensten Fragmente post festum einem Zusammenhang unterworfen, der durch keinen einzelnen Künstler in seinen Werken auch nur annähernd vollständig repräsentiert werden kann.
Der intrinsische Bedeutungszusammenhang ist aus der Gesamtheit aller künstlerischen Äußerungsmöglichkeiten einer Epoche eruierbar, wenn man annimmt, daß der naturevolutionär entstandene Weltbildapparat nur ein bestimmtes Repertoire von Formen des menschlichen Selbst- und Fremdbezuges ermöglicht, und daß es den einzelnen Künstlern nur gegeben sein kann, mit den kulturevolutionär entwickelten Sprachen diese lebensnotwendigen Selbst- und Fremdbezüge der Menschen situations- und zeitbedingt zu variieren.
Zeitbedingtheit als einzige Form eines Systemzusammenhanges? Einheit des Werkes und der Werke durch nicht mehr antizipierbare Bedingtheit der kulturellen Äußerungen? Gleichwertigkeit aller Fragmente durch Gleichgültigkeit?
Immerhin ließe sich mit dieser Auffassung einem kulturkritischen Diktum widersprechen, das besagt, erst in der Neuzeit sei der Anspruch, ein Ganzes und Vollendetes schaffen zu wollen, verlorengegangen; erst in der jüngsten Entwicklung menschlichen Zusammenlebens in den westlichen Industriegesellschaften hätte der Gedanke entstehen können, das Ganze als die Summe der Teile auszuweisen. Aber befriedigend ist das nicht; da hilft auch der Zynismus demonstrativen Verzichts auf die Erfahrung eines Ganzen und Vollendeten dem Künstler nicht.
Fragment und System sind auf eine andere Weise miteinander zu vermitteln, und so steht zu vermuten, daß man auch dort, wo man noch glaubte, die Kraft zur Vollendung seiner künstlerischen Taten aus der Kenntnis dessen ableiten zu können, was die Welt und die Werke tatsächlich im Innersten zusammenhält, nur dieser Form der Vermittlung des Einzelnen und des Ganzen, der Fragmente und Systeme zuarbeiten konnte: nämlich in der bewußten Hervorbringung von Ruinen, worin übrigens endlich auch einmal die beispielsweise von Freud angenommene Beziehung von Lust und Aggression, von schöpferischem und destruktivem Handeln vergegenständlicht wäre.
2 Ruinieren - ein handlungs- und erkenntnistheoretisches Konzept?
Auf dem Höhepunkt der Entwicklung von Landschaft als einem wesentlichen kulturellen Topos (also in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts), entwickelt sich auch das Ruinengenre in einem zuvor (seit dem Mittelalter) nicht gekannten Ausmaß.
In den drei unterscheidbaren Landschaftscharakteren der bildenden Kunst ist der Bezug auf das Ruinengenre unübersehbar:
In den topographischen Landschaftscharakteren erscheint seit dem Anfang des 16. Jahrhunderts die Ruine als eine Gegebenheit innerhalb eines objektiv vorliegenden Segments Natur (Ruine als Spur eines 'natürlichen' Verfallsprozesses: Reste einer alten Welt).
In den theatralischen Landschaftscharakteren figuriert die Ruine als Kulisse (wie das Ruinenbauwerk in Englischen Gärten).
In den monumentalisierenden Landschaftscharakteren (den heroischen wie den idyllischen) wird Ruine zur Allegorie bzw. zum Symbol: beispielgebend von Poussin in der Verschmelzung der Allegorie der Vanitas und dem Symbol für Arkadien herausgearbeitet.
Im Ausgang des 18. Jahrhunderts wird (durch die erste Welle der Industrialisierung) bemerkt, daß mit der Ruine die Vergegenständlichung eines spekulativen Prinzips gefunden worden war, welches alle Produktion beherrscht. Über dieses Verfahren des spekulativen Handelns und Erkennens, das ich mit seinem Ausdruck für Tätigkeit als das 'Ruinieren' bezeichne, will ich hier kurz nachdenken.
Zum Problem 'Landschaft - Ruine' liefert Hubert Burda als Schlußbetrachtung seiner Untersuchung 'Über die Ruine in den Bildern Hubert Roberts' (3) folgende Überlegungen:
"Jedoch zeigte sich im Lauf der Entwicklung des Ruinengenres, daß sich hinter der ruinösen Fassade der Architektur mehr verbirgt als bloßes Antikeninteresse. Dies muß vor allem für jene Bilder Roberts berücksichtigt werden, die im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als Landschaftsgärtner der Ruine den Rang eines Gartengebäudes zuweisen. Bis zu einem gewissen Grade ist die Verbreitung der Ruine im Englischen Garten zwar auch als Reflex der Antikenmode zu werten. Doch in der Hauptsache ist sie wohl mehr auf die besonderen Qualitäten der ruinösen Architektur zurückzuführen. Denn gerade ihr eignen vorzüglich all jene Kriterien des Pittoresken, dem nun ganze Abhandlungen gewidmet werden, und besser als jede intakte Architektur vermag es die ruinöse, sich in die von England aus den Kontinent erobernde Aufwertung des Naturbegriffes einzupassen.
Das ruinöse Gartengebäude unterscheidet sich grundsätzlich im Realitätscharakter von jeder anderen Architektur. Es will nicht betretbar sein, der Gegensatz von Innen und Außen ist aufgehoben, der gemäße Standpunkt des Menschen liegt in einer gewissen Distanz, wodurch das Gebäude einen kulissenartigen Charakter erhält. Diese Gartenarchitektur bietet kein Umraumerlebnis mehr. Sie reduziert das Verhältnis zwischen der Architektur und dem Menschen auf ein Gegenüber, vergleichbar der Schauseite einer Fassade. Zugleich ist sie nicht mehr eindeutig fixierbar. Anders als im Französischen Garten ist sie nicht in einen geometrischen Plan eingeordnet, sondern nach malerischen Gesichtspunkten komponiert, erhält damit etwas Unbestimmtes, Schwebendes, - ein Zug, den die ruinöse Silhouette noch verstärkt.
Der veränderte Realitätscharakter, den die Architektur im Bereich des Englischen Gartens annimmt, muß auch zum Verständnis der von den Gartenarchitekten unabhängigen Ruinenbilder Roberts herangezogen werden. Mit seinen Paris-Veduten bewies Robert ein spezifisches Interesse an agierender Architektur. Diesen Vorgang nannten wir 'Architekturschauspiel' - bewußt einen Terminus aufgreifend, der bislang nur im Bereich des Theaters verwendet wurde (Servandoni!). Der Einsturz der Architektur vollzog sich in der Ferne, vom Betrachter aus der Position des Zuschauers erlebt. Von der eigentlichen Gefahrenzone entfernt, betrachtet man das Schauspiel von dem gegenüberliegenden Ufer (Pont Notre-Dame), oder über einen trennenden Garten hinweg (Opernbrand), bzw. betritt man die Katastrophenstelle erst, wenn sich der gefährliche Zusammenbruch bereits ereignet hat (Hôtel Dieu, Pont-au-Change). Darin liegt ein wesentlicher Unterschied gegenüber dem Analogen des 16. Jahrhunderts (Palazzo del Te, Lonedo, 'Inventiones Heemskerckiane') . Dort vollzog sich der Einsturz der Architektur im Umraum des Menschen, er befand sich mitten darin (Sala dei Giganti), erlebte den Zusammenbruch 'existentiell', den Schock sozusagen am eigenen Leib.
Bei Robert wird den Vorgängen alles Bedrohliche genommen. Der Betrachter konstatiert vornehmlich das Transitorische des Geschehens, seine Aufmerksamkeit gilt dem "interessanten" Ereignis, wobei die Ruine folgerichtig ausgetauscht werden kann durch Wasserfälle, stürzende Bäume, überhängende Felsen - durch all jene Gegenstände, denen eine labile Struktur eigen ist. Entscheidend für die Auswahl der Bildobjekte ist allein ihre Fähigkeit, zu erhabenen Empfindungen anzuregen.
Also: die antike Welt - das Transitorische des Geschehens - und erhabene Empfindungen lassen die Ruine erlebbar werden: Vanitas und Arkadien. Das galt schon vor 1750, ist damals schon völlige Selbstverständlichkeit. Aber daß ein Naturbegriff entwickelt wurde, der ausgerechnet auf die Ruine hin, aufs Ruinöse verwiesen bleibt, das war die genuine Leistung des ersten Zeitalters der Industrialisierung."
Belege und Argumentation sehe sich bei Burda genau an, wer nicht ohne weiteres akzeptieren kann, daß vor allem anhand der ruinösen Architektur (als Bauwerk wie als Gemälde, Zeichnung oder literarische Form) der 'neue', eigentlich bis heute verwandte Naturbegriff exemplifiziert werden konnte: Landschaft ist ein Stück oder Segment Natur, das durch menschliche Wahrnehmungen und Handlungen überformt ist. Die Art dieser Überformung der Natur durch Wahrnehmen und Handeln läßt sich als ein Ruinieren beschreiben, wobei nur eine ganz formalistische Dialektik darin lediglich eine Pikanterie sehen würde, daß die entscheidende Form des Ruins gerade in der Gestalt einer 'heilen Natur' proklamiert wird. (Das ist der heutige Naturschutzpark.)
Aber, wenn 'Landschaft' nicht anders denn als durch Handeln und Wahrnehmen überformtes Segment der Natur verstanden werden kann - und wenn 'überformen' nichts anderes meint als 'ruinieren': Wo und wie ist dann Natur unüberformt, also nichtruiniert anzutreffen?
Gerade für die Erklärung dieser Frage, die ja von jedermann ohne weiteres als entscheidende erkenntnistheoretische Frage seit Kant (seit der ersten Industrialisierung) erkannt wird, erweist sich das Prinzip 'Ruinieren' in seiner ganzen Bedeutsamkeit. Natürlich gibt es nirgends für den Menschen die Möglichkeit, Natur zu erfahren, ohne sie zugleich mit den natürlichen und soziokulturellen Gegebenheiten der Wahrnehmung zu überformen - sie also immer schon als Landschaft zu sehen. Diese Wahrnehmungsgewohnheiten lassen sich ändern, und dann entsteht bei ausreichendem Training - eben ein neuer Landschaftstyp. Will man aber nicht nur immer im Karussell der zwar wechselnden, aber nicht veränderten Eindrücke verbleiben, will man 'Neues' als Faktum des Weltbestandes, als nicht wieder rückgängig zu machendes Faktum produzieren, so gilt es, Vergegenständlichungen des Wahrnehmens und Handelns zu finden, deren Sinn gerade darin besteht, aus der unaufhebbar gegebenen Verklammerung von Landschaft und Natur, von Oberfläche und Tiefe, von Wesen und Erscheinung, von Wahrnehmung und Wahrgenommenem hinauszuweisen. Eine solche Vergegenständlichung ist die Ruine.
Das Ruinieren wäre also ein Verfahren, die für jede Erkenntnis notwendige Differenz von Erscheinung und Wesen, von Gegenwart und Vergangenheit, von Wunsch und Wirkung, von Plan und Realisierung, von Entwurf und Verwirklichung herzustellen. Durch Ruinieren erzwingen wir die Differenzen im unterschiedslos uns Vorgegebenen; die Ruine ist die Vergegenständlichung der erzwungenen Differenz.
Wie wenig wir uns dessen bewußt sind, obwohl wir danach täglich verfahren! So konsumieren wir ausdrücklich Waren, die so produziert wurden, daß sie durch ihren Gebrauch zu Ruinen werden. Und wir haben ja auch schon ein Gespür für den Typus der monumentalen Landschaft, den unsere Abfallhalden repräsentieren.
So wissen wir um, ja fordern wir allenthalben die einheitliche Durchgestaltung eines Natursegments zur "Erholungslandschaft", "Fabrikationslandschaft", "Stadtlandschaft" reagieren aber mit automatischen Putzgesten, wenn wir in dieser Landschaft ein Autowrack - eine Ruine also - herrenlos herumliegen sehen. Reinigt die Wälder von Blechbüchsen und Kunststofftaschen, also von Ruinen, die sich ausschließlich aus der Nutzung dieser Wälder als Landschaften ergeben. Die Wälder selbst sind nichts anderes als ruinierte Natur, das bedeuten uns die Blechbüchsen und Colaflaschen. Natürlich ist es verständlich, daß man seine Wohnstube von den Ruinen des vorgängigen Lebens reinigt, damit darin weiter gelebt werden kann, was nichts anderes heißt, als weiterhin darin Ruinen zu erzeugen. Aber diese Reinigung ist richtigerweise nur eine Verlagerung des Sachverhalts, ist bloß Ritual, da der Dreck doch nie aus der Welt zu bringen ist. Ja - nicht einmal aus der Welt gebracht werden sollte, wenn wir nicht auf jede Art des Verweises aus dieser unmittelbar uns gegebenen Welt verzichten wollen.
Was hätten wohl unsere Archäologen uns Großartiges über die Welt von gestern zu sagen, wenn unsere Vorfahren tatsächlich den Dreck aus dem Haus, und nicht unter den Teppich geschafft hätten? Es ist ja doch jedermann klar, inwieweit wir von den Ruinen leben. Nur sollten wir uns auch langsam angewöhnen, in ihnen zu leben. Die Misere der modernen Nachkriegsarchitektur liegt doch nicht darin, daß unsere armen Architekten, die genialen Künstler, daran gehindert worden wären, ihre großartigen architektonischen Visionen auch in die Tat - also in gebaute Umgebung - umzusetzen. Das behaupten die Herren zwar immer wieder gern, um sich aus der Verantwortung zu stehlen, um die Misere anderen (den kommunalen Aufsichtsbehörden, den 'beschränkten' Bauherren) aufzuhalsen. Nein - der unmenschliche Zustand ist allein der Tatsache zu verdanken, daß die Architekten tatsächlich umstandslos ihre Vorstellungen realisieren konnten - und nicht bedachten, daß menschenwürdig und menschengerecht nur ist, was deutlich macht und sagt: Dies ist nicht, was es der Vorstellung nach sein sollte, dies ist nicht für die Ewigkeit; dies könnte auch ein anderes sein, es ist verwandelbar - aber auch verwandelt nur wieder ein Verwandelbares.
Kurz: Unsere Herren Architekten haben zu wenige Ruinen erzeugt, zuviel ganz und gar Verwirklichtes und zuwenig Unfertiges. Sie haben zuviel Systematisches konstruiert und zuwenig Fragmentarisches. Sie haben zuviel ausgeführt und zuwenig skizziert. Unsere Architekten haben zwar alle auch kunstgeschichtliche Unterweisung im Laufe ihres Studiums erfahren, aber sie haben offensichtlich nicht mitbekommen, was diese Kunsthistoriker - und selbst die bedeutendsten unter ihren Verächtern - längst zum fruchtbarsten Verfahren erhoben haben: Der Naivling restaurierte die Freskobruchstücke in Santa Croce zum 'wie neuen' Giotto; der Kenner konstruiert sie als Giotto-Ruine.
Sogar die Masse der Kulturtouristen würde heute schon mit Reiseverzicht drohen, wollte jemand den griechischen oder römischen Statuen und Bauwerken die fehlenden Glieder, Nasen und Giebel so ergänzen, als stünde die Antike wie einst nebenan. Gerade die totale Falschheit des Bildes von den antiken Statuen und Bauwerken, wie es anhand der marmorweiß geschrubbten, monochromen Oberflächen sich anbietet, enthält die Chance, aus dem zufällig uns so nun einmal Überlieferten hinauszukommen und zu erkennen, daß die antike Statue und das antike Bauwerk sowohl materiell wie der Funktion nach etwas völlig anderes gewesen sind, als wir es uns vorstellen können.
Was hält uns denn davon ab, diese ansonsten doch recht selbstverständlichen Sachverhalte auch in unserem Neuschaffen, in den gerade erst erbauten Lebensumgebungen zu berücksichtigen? Möchten wir den Verweis los sein, den die RuineN (und damit jede Erkenntnis) auf das Vergebliche und das Versagen geben? Auf den Verfall, auf Funktionslosigkeit, auf die Unwiederholbarkeit des einmal Gewesenen? Auf Krankheit und Zerstörung?
"Kommen Sie jetzt nach Deutschland", plakatierten Mitte der 50er Jahre Werbeagenturen in Amerika, "in zwei Jahren sehen Sie keine Kriegsruinen mehr - dann wird die Reise uninteressanter." Hat Eiermann im Interesse der amerikanischen Touristen den Turm der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche als Ruine ausgelegt? Man könnte es glauben, wenn man ihn sagen hörte, er habe den Turm als Ruine "stehenlassen", anstatt stolz zu dokumentieren, daß er wieder etwas von dem verstanden habe, was seinen Kollegen des 15. bis 18. Jahrhunderts selbstverständlich war, als sie (wie heute noch auf der Berliner Pfaueninsel zu besichtigen) nicht Ruinen stehen ließen, sondern schufen, immer aus ganz neuem Material.
Natürlich ist das nicht ohne weiteres zu verstehen, daß man mit schönem neuen, teuren Material alte 'verfallene' Ruinen baut, aber schließlich sind ja auch die neuen teuren Nichtruinen nicht ohne weiteres zu verstehen, schon gar nicht zu gebrauchen. Man muß schon etwas vom Wesen des menschlichen Treibens auf Erden verstanden haben, um zu begreifen, was jeder Theatergänger nach einiger Übung begreift: daß man in der Kostümschneiderei nach künstlerischen Entwürfen der Kostümbildnerin und unter Verwendung so teurer neuer Stoffe, wie man sie sich gerade leisten kann, Lumpen schneidert, weil im Stück Ruinen der Bekleidung verwendet werden müssen. Die einem Bettler auf der Straße ausgezogenen Kleidungsstücke könnte man nicht (und zwar aus Gründen der Hygiene) als Lumpen auf der Bühne verwenden, wie jeder vom Fache weiß: denn eine funktionstüchtige Ruine herzustellen, verlangt Anstrengung, Kenntnis und Fertigkeiten. Das wissen wir alle, denn wir sind ja auch bereit, uns selbst noch zu loben, wenn wir von jemandem auf unseren selbstverschuldeten ruinösen physischen Zustand hingewiesen werden. "Hat mich viel gekostet", antwortet der Dickbäuchige, den jemand auf ungesundes ruinierendes Fettfressen anspricht.
Damit es weniger Mißverständnisse geben möge, als sie ohnehin unvermeidbar sind, insistiere ich: Es ist sicherlich nicht als fruchtbares Handeln zu bewerten, daß eine Armee mittels Explosivkörpern Häuser in Ruinen verwandelt. Zweifel an der Sinnhaftigkeit des Verfalls eines Körpers, Bauwerks, Kleidungsstücks durch Alter oder Krankheit bestehen eh bei jedermann. Und schließlich möchten wir niemanden davon abhalten, etwas in die Welt zu setzen, bloß weil wir ihm versichern können, daß doch auch der dickste Eisenbeton einmal zur Ruine verfällt. Wir haben es zwar auch immer und überall mit den übriggebliebenen Spuren als Ruinen zu tun, sie geben aber nur Hinweis auf die Art, wie wir etwas aus der Welt schaffen - oder wie das Vergehen der Zeit sich als das Verschwinden der Welten bemerkbar macht.
Was uns aber wichtiger sein muß, ist zu erkennen, in welcher Weise Verschwinden und Erscheinen, In-die-Welt-Setzen und Aus-der-Welt-Bringen, Aufbauen und Abbauen, Fixieren und Löschen sich gegenseitig bedingen. Die Ruine ist die optimale Vergegenständlichung dieses Bedingtheitsverhältnisses.
Sich 'ruinieren' heißt als erkenntnistheoretische Position also, sich der Bedingtheit seines Erkennens und Handelns bewußt zu sein und so zu leben, als könne morgen schon alles ganz anders sein. Dem gilt es aber nicht so zu entsprechen, wie es sich die Aussteiger aller Schattierungen angediegen sein lassen: Von ihnen bleibt nicht einmal eine Ruine als bloße Spur eines Gewesenen. Vielmehr hat man die Anstrengung zu unternehmen, wenigstens aus Trümmern zu Ruinen aufzusteigen. Ruinen müssen gebaut werden, wie Bramante zwischen 1503 und 1513 den Cortile des Belvedere im Vatikan baute: als funktionstüchtig gemachte Apsis der Maxentiusbasilika, die Bramante ja in Rom als bloße Trümmerhaufen-Ruine vorfand. Das ist sprechende Architektur - ansprechende.
Hermann Graf Keyserling gibt in seiner 'Reise durch die Zeit' eine beachtliche Erklärung für die Anziehungskraft des Ruinösen, die sich mit unserer Auffassung ohne weiteres verträgt.
"Das Denken steht dem Sein gegenüber exzentrisch; Denken und Sein sind nicht eins, sondern sie stehen in einem solchen Wechselverhältnis zueinander, das jede Identifizierung ausschließt. Das Denken kann das Sein weder erschöpfen noch umschließen, sondern es bleibt stets außerhalb, an einem gleichsam exzentrischen Punkt, dergestalt, daß unsere Begriffe sich nie mit den Gegenständen, unsere Ideen sich niemals mit der Realität decken können und jedes konkret Erlebte oder Erschaute im Spiegel der Erkenntnis zu einem Abstrakten, also gänzlich Verschiedenen wird. Das ist eine kritische Erkenntnis Kants. Für Kassner ist nun das Gleiche ein dramatisches Erlebnis. Ich lege meine Hände ins Feuer dafür, daß sein einziges Erlebnis nichts anderes besagt als die benannte kritische Erkenntnis. Aber für Kassner ist das Abstrakte, das für Kant nur zu Denkende, ein persönlich Empfundenes, und Kritik der reinen Vernunft wird zu einem Drama, ja zu einer Tragödie." (4)
Was Keyserling für einen seiner Paradefälle anführt, gilt bereits für die früheste Rezeption Kants durch die Romantiker, erreicht bei Nietzsche und Klages einen extrem wirksamen Höhepunkt, bildet das Kernstück aller Politik der Ekstase (also auch des Nationalsozialismus) und erreicht gegenwärtig in Ulrich Horstmanns 'Konturen einer Philosophie der Menschenflucht' den Anschluß an den Zeitgeist der Mitte der 80er Jahre. Was wir als den Vermittlungscharakter des Ruinösen, also als die eigentliche Leistung der Differenzphilosophie zu würdigen haben, und was den Skeptizismus und die kritische Philosophie zum Fundament anstatt zur Auflösung des menschlichen Erkenntnisanspruchs werden läßt, ist vor allem Künstlern als das Eingeständnis intellektueller Ohnmacht oder moralischer Selbstverstümmelung erschienen. Das war zumindest so lange verständlich, als für die künstlerische Produktion die möglichst umfasssende Angemessenheit von Form und Inhalt, von Material und Ausdruck, von Absicht und Methode entscheidendes Kriterium der Güte gewesen ist. Den Künstlern war es dann aber nicht mehr möglich, die nur als ästhetische Dimension thematisierbare Differenz von Begriff und Anschauung in ihren Werken tatsächlich zu vergegenständlichen. Von diesem schier unerträglichen Druck konnten sie sich nur entlasten, wenn sie entweder die kritische Erkenntnis oder das seelische Erlebnis verabsolutierten beziehungsweise eliminierten. Beide Reaktionen laufen auf das gleiche hinaus, auf den heroisch pathetischen Versuch der Selbsttranszendierung durch Verwandlung als der Zerstörung, durch das reinigende Feuer, durch Menschheitsdämmerung, durch die Ekstase des Selbstopfers.
Für den Zeitgeist in der Mitte der 80er Jahre empfiehlt Horstmann erneut den Titanismus der Großdenkerei.
"Der Nutzen unseres Denkapparates könnte vielfältiger, die Vorteile, die wir ihm verdanken, größer nicht sein. Denn zum einen verschafft er uns durch seine waffentechnische Kompetenz die Mittel, ohne die wir die Trägheit unseres Fleisches in alle Ewigkeit nicht würden überwinden können. Zum anderen liefert er die Rechtfertigungen und Rationalisierungen, die das Untier für seine rastlosen militärischen Exerzitien so dringend benötigt, um jenen Verlockungen zur Untätigkeit, Sanftmut und Toleranz zu widerstehen, die ein pazifistisches Phlegma als 'Stimme des Gewissens' feilbietet. Und drittens und letztens reflektiert er in der anthropofugalen Spekulation auf sich selbst zurück, erkennt die genannten Funktionen als sinnvoll und richtig und ringt sich zu der heroischen und jedes andere Wesen in den Irrsinn treibenden Einsicht empor, daß er im Kosmos durchaus fehl am Platze ist, sich aufgrund seines eigenen evidenten Räsonnements das Existenzrecht absprechen muß und also die vordem unbewußten Anstrengungen der Gattung, sich selbst dem Nichts zu überantworten und damit dem perennierenden Leiden Einhalt zu gebieten, nicht nur nicht zu unterlaufen, sondern vielmehr aus vollem Herzen zu fördern, zu bejahen und mit der Gloriole des summum bonum aufzuwerten hat." (5)
Mit diesen Reaktionen wird von allen anderen Einwänden abgesehen, klar und unmißverständlich der Vermittlungscharakter der Ruine aufgegeben - noch die Ruinen werden Ziel einer selbst auferlegten Zerstörungspflicht. Vom Zerschlagen der versteinerten Systeme, von Fragmentarisierung, von Summe oder Ganzheit, von Totalität oder Gegenwelt bleibt offensichtlich nicht einmal die Anstachelung zum Selbstmitleid. Solche Männer weinen nicht, solche Philosophen lassen sich keine halben Sachen durchgehen. Wer aufs Ganze geht, kann auf nichts historisch Konkretes mehr Rücksicht nehmen.
3 Gegen die Ästhetik des Kaputten
Eine Typologie des Aus-der-Welt-Bringens
Seit dem Beginn der Industriellen Revolution, also seit etwa 200 Jahren, verdichtete sich die Selbstrechtfertigung unserer Zivilisation zu einem Mythos der schöpferischen Hervorbringung, der es mit dem alttestamentarischen Pendant zumindest aufnehmen können sollte. Alle Gedanken drehten sich um Steigerung der Schaffenskraft, Erhöhung der Produktionskapazität und Koordination vieler einzelner, in sich sinnloser Arbeitsschritte zu einem nur als Ganzem sinnvollen, also zu einem System. Im Unterschied zum biblischen Gott lieferte der Schöpfer aber als Wissenschaftler, Ingenieur, Erfinder und Organisator nur noch die Pläne der Schöpfung, die Ausführung übernahmen die Geschöpfe selber. Diese sich selbst schöpfenden Geschöpfe konnten ihre Kreativität weit über die des biblischen Gottes steigern, so daß die Welt in absehbarer Zeit bis in den letzten Winkel mit ihnen angefüllt sein würde. Mußte das nicht schließlich zum Stillstand aller Produktion führen? Und bedeutete nicht Stillstand das Ende als Tod? Schon im 19. Jahrhundert gingen eine Reihe von Denkern gegen dieses drohende Ende mit der Empfehlung an, man möge schnellstens auch die Selbstschöpfung des Menschen jenen Gesetzen unterwerfen, denen die Schöpfung Gottes unterlag; sie empfahlen einen permanenten Bürgerkrieg als Entscheidung darüber, wer der Fähigste sei und überleben dürfe, wo nicht alle Platz haben. Da ein solcher Kampf mit der offiziösen christlichen Ethik zu kollidieren schien, überhöhte man den Kampf aller gegen alle zu einem Gesetz jeglicher Entwicklung. Entwicklung wurde dadurch nebenbei zu einer Art Wandlung umdefiniert: an die Stelle des Wandlungsläutens mit dem Meßdienerglöckchen trat das Donnern der Kanonen und das Krepieren der Bomben. Fortschritt durch Zerstörung hieß das neue Lösungswort für den, wenn auch vorerst nur vorgestellten, Zustand einer Welt, die sich durch Entfaltung selbst vernichtet, durch Pflege zerstört, durch übermäßige Fruchtbarkeit in Wüste verwandelt wird. Durch Untergang zur Auferstehung, per aspera ad astra, per Apokalypse zur Wiederkehr des Herrn sind Maximen, die es selbst einem Christen zur Pflicht machen, seiner übergroßen Leistungsfähigkeit und Schöpferkraft eine ebenso große Zerstörungskraft, ein zumindest gleichwertiges Aggressionspotential kontrollierend an die Seite zu stellen.
Und ist das nicht wirklich Zeichen größten Verantwortungsbewußtseins, nicht mehr länger nur im Omnipotenzrausch fortwährend mehr zu produzieren, als man selbst verbraucht, sondern das Aus-der-Welt-Bringen, das Zerstören, das Kaputtmachen als ebenso schöpferische Kraft zu verstehen? War vielleicht in dieser Weise sogar schon das antike Diktum zu verstehen, der Krieg sei der Vater aller Dinge? Wenn Neuschaffen doch immer nur ein Verwandeln durch Zerstörung bedeuten mußte, konnten sich die Konkurrenten Gottes sehr viel eher die Weihen der historischen Größe durch Zerstörung, durch Feldherrntaten und Herostratentum beschaffen als durch Aufbau dessen, was es denn ohnehin zu zerstören galt.
Hinweise auf die diesbezüglichen Laufbahnen schöpferisch besonders Begabter oder auch nur besonders ehrgeiziger Individuen erübrigen sich: Man muß aber immer wieder daran erinnern, daß zum Beispiel unter Künstlern ein Großteil solcher Ambitionen tatsächlich durch Selbstzerstörung der Individuen erfolgreich verwirklicht wurde. Zumindest ist für die Künstlerideologie des 19. Jahrhunderts Selbstzerstörung durch Rauschmittel, die Überhöhung des Todes in der Gosse, Selbstinfektion mit tödlichen Krankheiten, Verbrechermut und Auszeichnung durch Verworfenheit symptomatisch.
Auch um diese Positionen kann es heute nicht mehr gehen. Ebensowenig wie um die der Abräumdenker, kindischen Selbstopferer, titanischen Nihilisten und heroischen Ekstatiker, die den Wahnsinn als Zeichen der Auserwähltheit gewertet wissen wollen. Eher schon darf man sich den Zynikern anvertrauen, wenn es denn zynisch ist, etwa unsere Ruhrgebietsstädte oder gar die gesamte bundesrepublikanische Nachkriegsarchitektur der Schönheit ihrer Häßlichkeit wegen zu preisen. Daß das eigentlich Schöne als solches unter den Bedingungen eines elenden Lebens selbst häßlich geworden ist, kann man verstehen. Ein Raffael im Dortmunder Dreck ist eine bodenlose Niedertracht. Der Raffael regt nur noch das Erbrechen an oder den Griff zur Axt. Aber den Dortmunder Dreck wie einen Raffael zu betrachten, zu deuten und zu würdigen, scheint allen jenen die letzte Rettung durch Selbstüberhöhung, die sich immer noch nicht damit einverstanden erklären wollen, daß Zerstörung die einzige Form von Verteidigung sei. Aber wer kann es sich schon leisten, zynisch zu sein, wenn er nicht gerade von Beruf Feuilleton-Redakteur ist, wenn er also nicht gerade für die Verwirrung von Spiel und Ernst, Sein und Schein, Oberfläche und Wesen, Denken und Tun bezahlt wird. Der Sinn dieses Spiels ist es, Schreibtischtätern allen Einfluß zu sichern, sie aber zugleich von jeder Verantwortung freizusprechen. So angenehm der Hautgout des Bösen auch den - ja, wie nennen das die Herren? - auf Durchschnitt herunterdemokratisierten Geistern in die Nase stechen mag; so interessant auch die Attitüde spätexistentialistischer Geworfenheit beamteter Professoren oder unkündbarer Angestellter bei Ladies als Legitimation für einen Essay über Todessehnsucht akzeptiert werden mag; so sehr auch Präsidenten und Minister, Militärs und Priester das angehäufte Zerstörungspotential als Kraft der Verwandlung des irdischen Jammertals in Gottesreiche auszugeben vermögen, es ist in ihrem schändlich gottgleichen Tun nicht einmal der Hinweis darauf zu finden, wie denn hinfort Hervorbringen und Zerstören vermittelt werden müßten.
Wir erinnern uns ja wohl noch des ungläubigen Staunens, als wir erfuhren, daß zum Beispiel unsere Chemiekonzerne fast ein Jahrhundert lang den Abfall so behandelten, als gehöre er gar nicht zum Produktionsprozeß. Produktionsrückstände, wenn auch nur als relativ harmlose Verschmutzungen, geschweige denn als hochwirksame Gifte, einfach irgendwo in die Gegend oder ins Meer zu kippen und dabei aus tiefstem Herzen überzeugt zu sein, daß die Produkte dieser Chemie für die Menschen so nutzbringend seien, daß man die Chemiker namentlich in die Abendgebete einzuschließen hätte - das erst, und nicht das bewußte Vabanquespiel verbrecherischer Industrieller zeigt die Bedeutung des Problems. Jede Durchschnittstype kann heute mit etwas Kapital und know how auf Deubel komm raus produzieren. In Wahrheit hat er nichts als Zerstörung betrieben, solange er die unerwünschten Folgen seiner Produktion, also die giftigen Abfälle, nicht auf gleich nützliche Weise aus der Welt bringt, auf die er seine Lacke oder Imprägniermittel in die Welt gebracht hat.
Probleme zu lösen, kann immer nur heißen, neue Probleme zu schaffen. Aber nur solche Problemlösungen als Schaffen von Problemen sind akzeptabel, deren unumkehrbare Folgen kleiner, d. h. weniger wirksam sind als die des ursprünglich zu lösenden Problems. Wer das Problem mangelnder Energie durch den Aufbau einer Plutoniumwirtschaft zu lösen verspricht, ist heute weder als glanzvoller Krimineller noch als heroischer Nihilist oder als gläubigster Judas gerechtfertigt.
Natürlich mag es etwas verwegen klingen, akzeptable Formen der Vermittlung zwischen Hervorbringen und Zerstören, zwischen Produktion und Konsumption ausgerechnet aus dem Bereich der bildenden Kunst zu präsentieren. Sei es drum: Joseph Beuys gibt tatsächlich einen zeitgemäßen Begriff jenes zu vermittelnden Zusammenhangs, wenn er auf dem Friedrichsplatz in Kassel zur documenta 7 eine seiner Plastiken aus Basaltsteinen in Dreiecksform auflhäuft und eine Spitze dieses Dreiecks auf ein frisch gepflanztes Eichenbäumchen weisen läßt. Der Wirkungsanspruch seines künstlerischen Konzepts wird erfüllt, wenn diese Skulptur als Beuys' Werk zu existieren auflhört, weil interessierte Bürger einen oder mehrere der Basaltsteine abtransportieren, um sie jeweils neben ein frisch gepflanztes Eichenbäumchen in den Boden einzulassen. Wer den Steinhaufen als Beuys' Kunstwerk bewahrt wissen will, verhindert seine Wirkung. Wer das Beuys-Werk aber wirksam werden läßt, bringt es zum Verschwinden. Ja, das ist in der Tat eine beispielhafte Vermittlung von In-die-Welt-Bringen und Aus-der-Welt-Bringen, von Schöpfung und Zerstörung. Zugleich erbringt die Arbeit von Beuys den Beweis, daß altchristliche und altphilosophische Gottesimitatoren mit ihrem Anspruch scheitern mußten, Zerstörung sei nach dem Muster der Apokalypse die bedeutendste Form der Hervorbringung von etwas unveränderbar Ewigem, unbezweifelbar Dauerndem, also von systematisch hergestellter Totalität, die auch noch sich selbst als einen Teil enthält.
Man kann nicht behaupten, daß im Bereich der bildenden Kunst der Gegenwart derart gelungene Beispiele für die Vermittlung von Fragment und System, von Zerstören und Hervorbringen zahllos wären. Auf jeden Fall aber sind sie in keinem anderen Bereich so zahlreich zu finden wie in der Kunst.
Das Altern der Kunstwerke ist nur auf eine sehr oberflächliche Weise, nämlich für Restauratoren, ein Akt der Zerstörung. Altern hängt auch nicht an der kalendarischen Distanz zum Herstellungsjahr eines Werkes. Altern heißt im besten Sinne Kompensation der Zumutung, die jedes Kunstwerk für den Betrachter darstellt, da sie sich mit der Gewöhnung neutralisiert. Die schöpferische Kraft der Eingemeindung durch Vergessen, durch Ablagerung auf den Haufen des eigentlich Entbehrlichen, schafft die Voraussetzung dafür, daß alte Formen neue Bedeutungen zu transportieren vermögen. Die entscheidenste Bedeutung alles einmal Hervorgebrachten ist die eines musealen Zeugnisses für die bis dahin verpaßten Gelegenheiten in der Geschichte einer Kulturgemeinschaft.
Aber: Was im Museum diese Kraft der Erinnerung an unumgängliche Verluste, an Verzicht auf Titanismus und Gottesanmaßung zu bezeugen vermag, stammt aus dem Müll und ist nicht wiederauferstanden aus Ruinen. Alles aus Ruinen Wiederauferstandene, Restaurierte und Rekonstruierte ist ja doch nur Fälschung und bloß vorgespielte Authentizität. Der Begriff der Authentizität läßt sich allein aus der uneinholbaren historischen Differenz entwickeln, in der man das Drama der Erkenntnis und die Tragödie des Menschen als Schöpfer auszuhalten fähig ist.
Vor allem die Kunst dieses Jahrhunderts und die aus ihrem Gegenstandsbereich auf das Alltagsleben übertragenen Erkenntnisleistungen (Besetzung von auf den Müll geworfenen Häusern) sollten unser Interesse am Ruinieren als handlungstheoretisches Konzept so weit bestärken, daß wir auf die Verlockungen auch der totalsten Zerstörung nicht hereinfallen.
1 In: Lucien Dällenbach und Christian L. Hart Nibbrig (Hrsg.): Fragment und Totalität,Frankfurt 1984
2 Heinz Althöfer: Fragment und Ruine,in: Kunstforum International, Bd. 19,1/77
3 Hubert Burda: Über die Ruinen in den Bildern Hubert Roberts, München 1967
4 Hermann Graf Keyserling: Reise durch die Zeit, Vaduz 1948
5 Ulrich Horstmann: Das Untier - Konturen einer Philosophie der Menschenflucht, Wien 1983
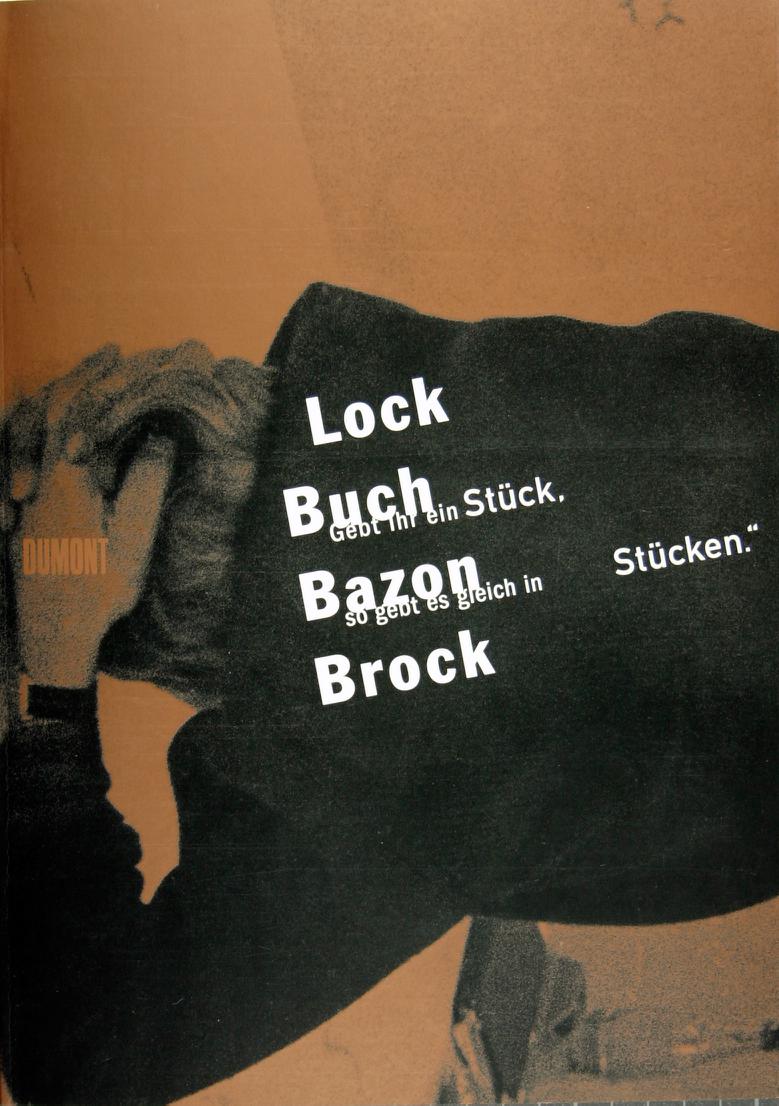 + 3 Bilder
+ 3 Bilder
